Archiv: Bücher
RH Bd. 03 – Wiederkehr der Lyrik? Kritische Dialoge 1963–1979
Hans Henny Jahnn. Eine Bibliographie
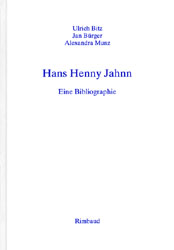
Die vorliegende Bibliographie beseitigt den seit Jahren wiederholt kritisierten Umstand, daß einerseits das von Jochen Meyer 1967 vorgelegte «Verzeichnis der Schriften von und über Hans Henny Jahnn» (ergänzt in der 3. Auflage des Heftes Nr. 2/3 von TEXT+KRITIK), das über lange Jahre als zuverlässiger Begleiter jeder Lektüre der Werke diente, keine angemessene Fortführung erfahren hat, und andererseits die mit dem Erscheinen der «Hamburger Ausgabe» zunehmende Beachtung von Jahnn in der literarischen Öffentlichkeit und der Forschung sich nirgendwo verzeichnet findet. Darüber hinaus konnte, was Jochen Meyer noch nicht möglich war, der an der Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky in Hamburg archivierte Nachlaß in einem für die Bibliographie angemessenen Maße ausgewertet werden. Ganz zu schweigen von den seit 1967 bekannt gewordenen Überlieferungssträngen, die sich in den Nachlässen von Jahnn nahestehenden Personen in in- und ausländischen Bibliotheken finden.
Ernst Meister Jahrbuch 05. 1997
Beiträge von Dieter Breuer, Klaus Johann, Ursula Gundlach, Markus Bauer, Rolf Bulang, Dieter Bänsch, Friedemann Rosdücher, Martin Linnhoff, Richard Dove, Jürgen Egyptien, Dieter Breuer, Reinhard Kiefer
15 Abb., 130 S., brosch., 1998
Männer-Fotografien
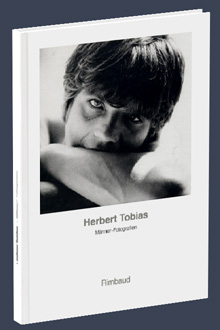
KS Bd. 05 – Die erste Liebe. Le premier amour

Die Übertragung von Karl Schwedhelm stammt aus dem Jahre 1947. Sie ist Bestandteil einer auf acht Bände angelegten Werkausgabe, wovon sechs bereits erschienen sind.
Zu den Gedichten von Marceline Desbordes-Valmore:
Wenn mit diesen Gedichten die Macht des Leisen aufgerufen wird, so scheint einem solchen Unternehmen wenig Berechtigung beschieden in einer Zeit, die noch widerklingt von dem dröhnenden Nachhall ihres unbarmherzigsten Unwetters. Müssen solche Gedichte in unserer Welt der Trümmer, auf der Schädelstätte menschlichen Leides nicht wie ein Anachronismus wirken? Denn es sind Gedichte, in denen nichts als subjektive lyrische Aussage lebendig ist, persönliches Schicksal einer sensiblen und romantischen Frauenseele, in ihrer Verletzlichkeit etwa der Günderode benachbart, zerbrechlicher und wohl auch enger im Fraulichen verhaftet als die Droste – und doch beiden Frauen nicht allein durch lose Zeitgenossenschaft verbunden.
Gewiß, einzelnes aus den zehn Gedichtbänden, die zu Lebzeiten der Dichterin von ihr in Druck gegeben worden sind, will uns heute allzu ichbezogen dünken, erweckt kaum mehr als den Eindruck verliebter Versenkung in die schmerzlich-süße Bitternis ihres Geschicks, vermag uns nur als ein zärtlicher Kult mit dem Leiden anzusprechen.
In den weitaus meisten ihrer Schöpfungen aber findet diese Frau Verse von einer bezwingenden Eindringlichkeit des Fühlens, weiß um die Kunst der leisen Zwischentöne im Ausdruck, wie es sonst nur den Größten ihres Jahrhunderts vergönnt war. Und sie besitzt – was in der französischen Dichtung sehr selten ist – die liedhafte Ursprünglichkeit der Stimmung.
Ein Leben voller Trauer und Prüfungen und als dessen Auftakt ein tragisches Liebeserlebnis in der Jugend: der Schmerz darüber, von einem mit allen Sehnsüchten ihres Wesens geliebten Manne hintergangen und – was ihr mehr gilt – nicht geliebt worden zu sein, läßt diese Frau Trost und Zuflucht im Wort finden: sie wird zur Dichterin. Allzu schmal mag manchem solche Basis ihres Dichtertums erscheinen, entscheidend bleibt, daß eine flutende Fülle unvergänglicher Verse daraus entstammt; wollen wir den Strom, der ein ganzes Land fruchtbar macht, nach seiner Quelle im Berggestein fragen?
Wenn heute der durch blinde Torheit sehr zum Nachteil deutschen Wesens lange verriegelte Zugang zum reichen Bildersaal des französischen Geistes wieder gesucht wird, erinnere man sich, daß Verlaine diese dichtende Frau die größte in der französischen Poesie genannt hat und daß vor fünfundzwanzig Jahren Stefan Zweigs unvergessene Würdigung ihres tragisch beschatteten Erdenweges nur die wenigsten erreichte. So schien von mehreren Seiten her die Rechtfertigung für dies schmale Büchlein gegeben.
Eine Übernahme der Dichtungen in den deutschen Sprachraum war nicht möglich, ohne zu dem besonderen Ausdruck der Marceline Desbordes die deutschen Entsprechungen in ihrer Zeit, eine romantisch-impressionistische Formenwelt in Bild und Sprache aufzusuchen.
Der Übersetzer hat es als seine Aufgabe betrachtet, eine möglichst schlichte Form für einen Lied gewordenen «crève-coeur» zu finden, dessen mütterlich-weibliche Hintergründe, fern allem literarischen Ehrgeiz, durch ihr echtes, anspruchsloses Gefühl auch heute noch zu ergreifen vermögen. Die schwebend-feinen Unterschiede zwischen dem franzözischen «coeur» und «âme» sowie dem deutschen «Herz» und «Seele», zweien der Lieblingsbegriffe der Marceline, mußten dabei in mannigfachen Abstufungen wiedergegeben werden. Haben sie doch auch in der Terminologie der Dichterin selber einen Wandel durchgemacht.
«Les fleurs amères» möchte man, Baudelaires schönen Titel abwandelnd, dieses Bändchen heißen und Blüten des Leides wahrlich sind die Strophen der unglücklichen Frau in einem sehr edlen Sinne. Daß ihr das Leid mehr bedeutete als dumpf verhängtes Schicksal, daß es Kräfte des Geistes und der Seele frei werden ließ, die in ihrer Mütterlichkeit auch uns zur Tröstung dienen können, daß aus dem Leide in Wahrheit «Blüten» sproßten, möge dieser Versuch einer Nachdichtung erweisen.
Karl Schwedhelm
Osiris. Zeitschrift für Literatur und Kunst. Heft 01. 1995
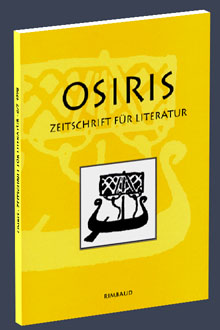
Aus dem Inhalt:
Notizen
Rudolf Hartung
Reinhard Kiefer
Albrecht Fabri
Gedichte
Erich Arendt
Joachim Sartorius
Ulrich Berkes
Hans Weßlowski
Lothar Klünner
Gerhard Neumann
Korrespondenz
Johannes Bobrowski – Erich Jansen
«Das Unmögliche»
Rudolf Hartung: Tagebuch
Mauer-Tagebuch der Pariser Maitage
Max Hölzer an Michael Guttenbrunner
Max Hölzer: Gedichte
Henri Michaux: Die Verwüsteten
Miszellen
Rudolf Hartung: Marcel Reich-Ranicki
Bernhard Albers: Benns Irrtum
Theo Buck: «lebensspuren» von Wulf Kirsten