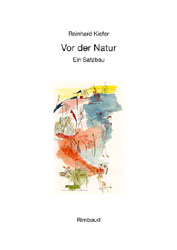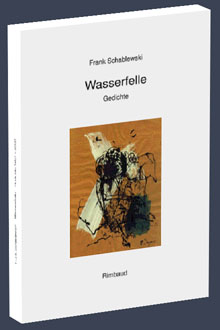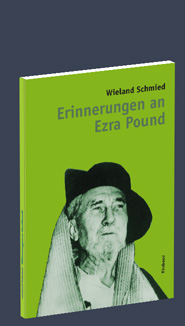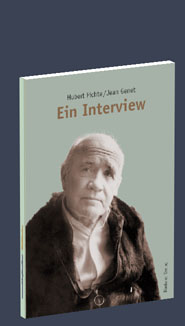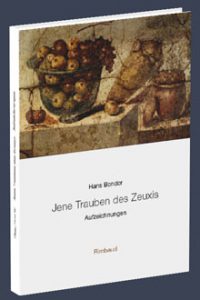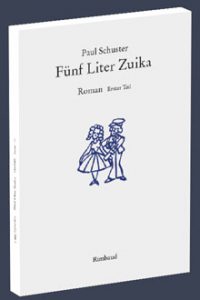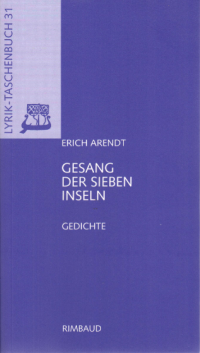[…] Hans und Lisa, diese Namen stehen für Heinz und Lilly: den am 14. Januar 1909 in Czernowitz geborenen und dort als Rechtsanwalt tätigen Dr. jur. Heinz Kehlmann und seine Frau Lilly, die am 25. Januar 1903 geborene, jüngste Tochter des in der Bukowina bekannten Strafverteidigers und Präsidenten der Anwaltskammer, Dr. Jakob Ausländer. Nachdem Lilly an der Czernowitzer Universität das Lehramt für Deutsch und Französisch erworben hatte, wechselte sie in ihren Wunschberuf über; nach mehrjähriger Ausbildung an der Kunstgewerbeschule Wien wurde sie eine erfolgreiche Graphikerin und Malerin. 1940 heiratete sie Heinz Kehlmann, nachdem ihre Ehe mit dem Schriftsteller, Literaturkritiker und sozialdemokratischen Politiker Lothar Rădăceanu 1940 geschieden und in Freundschaft abgewandelt worden war. Mit Heinz Kehlmann teilte Lilly ein schweres Emigrantenschicksal; es führte das jüdische Ehepaar nach turbulenten Kriegs- und Fluchtjahren aus dem 1944 von den Russen eroberten Rumänien 1948 in die Schweiz, 1949 nach Frankreich und 1953 in die USA.
Die älteste Schwester Lilly Kehlmanns, Ninon Ausländer, gesch. Dolbin, lebte seit 1926 mit dem Dichter Hermann Hesse in Montagnola bei Lugano zusammen und hatte ihn im November 1931 geheiratet. Sie verhalf Kehlmanns zur Ausreise aus Rumänien, um sie bei sich aufzunehmen. Sie durften als «Staatenlose» vom Februar 1948 bis zum April 1949 in Montagnola bleiben, dann mußten sie – trotz aller Bemühungen Hermann und Ninon Hesses – auf Grund einer fremdenpolizeilichen Verordnung die Schweiz verlassen. Dies alles – Ninons Verhältnis zu Lilly seit der gemeinsamen Kindheit in der Bukowina, ihre Ehe mit Hermann Hesse, das Wiederfinden der im Krieg verschollenen geglaubten Schwester, Kehlmanns Aufenthalt im Hause des Dichters und die darauffolgende lebenslange Korrespondenz zwischen den Schwestern – dies alles wird in der Doppelbiographie «Zwischen Welt und Zaubergarten, Ninon und Hermann Hesse» von Gisela Kleine (suhrkamp taschenbuch 1384), faktengetreu dargestellt und bietet somit Zugang und Ergänzung zu Heinz Kehlmanns «halb-autobiographischer Schilderung», indem darin der wahre biographische Hintergrund – ohne fiktive Verfremdungen – aufgedeckt wird.
Kehlmanns zeitgeschichtlich bedeutsames Dokument endet mit Hans’ und Lisas Einschiffung in Le Havre und dem Hinweis auf deren gedrückte Lebensstimmung, die dem von «Lämmern auf dem Gang zur Schlachtbank» gleiche. An anderer Stelle bemerkt Heinz Kehlmann, Lisa-Lilly habe ihm während der eintönigen Atlantiküberquerung gestanden, daß der Drang nach Westen, der seit undenklichen Zeiten die asiatischen und osteuropäischen Völker beseelt habe, auch ihr, ihren Eltern und Geschwistern nicht fremd gewesen sei. Immer hätten sie in die westlichen Kulturzentren – Wien, Berlin, Paris – gestrebt, doch wahrlich, so weit nach Westen habe sie nie gewollt.
Sicher wünscht mancher Leser nach diesem Eingeständnis von Furcht und Unsicherheit vor dem Abenteuer New York einen Ausblick auf den weiteren Lebensweg des Paares. Dazu ist ein Sprung in die Realität notwendig:
Nach der Ankunft in New York erhielt Heinz Kehlmann sofort eine Arbeitserlaubnis. In der Versandabteilung einer Spielwarenfabrik vernagelte er 1953 die auszuliefernden Kisten. 1954 gelang es ihm, eine Anstellung als «Privatbeamter» bei der Firma Vandenbrook zu erhalten, nebenbei studierte er in Abendkursen Literatur und Bibliothekskunde, wodurch ihm 1962 der Grad eines «Master of librarian science» zuerkannt wurde. 1963 bekam er als Bibliothekar in der New Yorker Public Library Queens eine Anstellung als Abteilungsleiter mit 32 ihm zugeteilten Mitarbeitern; 1972 wurde er dort pensioniert und übersiedelte mit Lilly, die in New York nie heimisch geworden war und sich nach Europa sehnte, in das ihr vertraute Wien; dort erlag er am 4. Januar 1979 einem Herzinfarkt. Nur sechs Jahre überlebte Lilly den Gefährten, mit dem sie das in seiner Geschichte von Hans und Lisa gespiegelte, wechselvolle Schicksal geteilt hatte. Sie starb am 14. Juli 1985 in Wien.
Gisela Kleine
Heinz Kehlmann
So weit nach Westen
Von Czernowitz nach New York
Rimbaud, Aachen
114 S., brosch., 2004