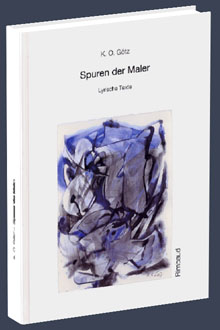LTB 010 – Wegmarken
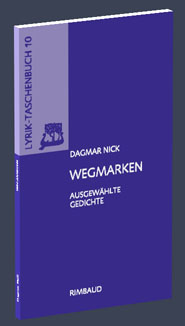
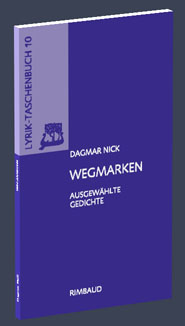

«Der Wandelstern» ist kein trauriges, eher ein offenbarendes Buch, dem Wilhelm Hausenstein in der Frankfurter Zeitung, kurz nach Barths Tod, eine «Art von Vollkommenheit» nachrühmte.
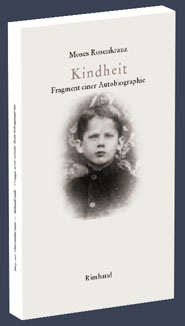
Der Autor, geboren am 20. Juni 1904 in Berhometh am Pruth, lebte bis 1930 vorwiegend in der Bukowina, dann in Bukarest. 1941 bis 1944 war er in Arbeitslagern der rumänischen Faschisten interniert; 1947, verschleppt nach Rußland, verschwand er für 10 Jahre im Gulag. 1961, wieder politisch verfolgt, mußte er aus Rumänien fliehen und kam nach Deutschland. Er starb am 17. Mai 2003 im Schwarzwald.
Die Kindheit erlebte er bis zum 1. Weltkrieg in den Dörfern zwischen Pruth und Czeremosch in einer kinderreichen Bauernfamilie. Dann folgten Flucht, der Tod des Vaters, völlige Verarmung; danach Wanderjahre auf Arbeitssuche.
Weiteres zum Lebenslauf im oben genannten Essay von Matthias Huff.
Die ersten fünfzehn Jahre dieses Lebens, das noch viele Katastrophen unseres Jahrhunderts durchlaufen sollte, schildert der Dichter im vorliegenden Buch.
«Sehr fremd und unheimlich vertraut mutet diese Geschichte an, rücksichtslos schön erzählt, zart und rabiat im Wechsel, der Umstände halber häufig düster. […] ‹Kindheit› ist […] ein Kleinod von besonderer, im wahrsten Sinne seltsamer Größe.»
«Von keiner Utopie läßt sich [Rosenkranz] sich etwas vormachen; keine Ideologie kann ihn über die Realität hinwegtäuschen.»
«… Das Wunder dieses Buches ist Rosenkranz’ Deutsch, das so wenig standardisiert ist wie sein ganzer Bildungsgang und sein Lebenslauf. Es ist ein intensives, hochpoetisches, präzises, wie hastiges und zugleich unverbildetes Deutsch, das Resultat des Versuchs, gewissermaßen dichterisch und unmittelbar auf die Möglichkeiten der deutschen Sprache durchzugreifen. […]
Diese gar nicht herleitbare Liebe zum Deutschen prägte, zusammen mit der Geschichte dieses Jahrhunderts, sein Leben, und wir haben den Gewinn in Gestalt eines dichterisch bedeutenden und als Zeitzeugnis unvergleichlichen autobiografischen Fragments […]»
«Eines der schönsten Bücher aus jüngster Zeit sind die Kindheitserinnerungen von Moses Rosenkranz, der uns bislang vor allem als Lyriker bekannt war. […] Rosenkranz schildert das Leben jüdischer Kleinbauern, und das ist neu und spannend, aus direkter Nähe, aus der Perspektive des Kindes, eng vertraut mit Tieren und ländlicher Arbeit. […] Das zentrale Ereignis dieser Kindheit zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist der große Krieg, der die scheinbar so festgefügte Welt wie ein Kartenhaus zum Einsturz bringt. Der Krieg erscheint dem jungen Moses als Aneinanderreihung absurder Episoden […], erzählt in dieser wunderbaren Sprache, die Rosenkranz als großen Prosadichter auszeichnet.»
Im Frühherbst 2018 meldete sich ein Pfarrer und Psychologe aus Hessen bei dem Verleger Bernhard Albers mit dem Hinweis, der Dichter Moses Rosenkranz habe sich an Jungen sexuell vergangen. Der Rimbaud Verlag hatte alle Bücher ediert, die seit den 1990er Jahren von Moses Rosenkranz erschienen sind. Bernhard Albers hatte die Idee, die Erinnerung in der Form eines Gesprächs festzuhalten – ein Akt des Beistands, der entsetzliche Fragen aufwirft: Wie kann ein Mensch, zumal ein Mann von Geist, der zur NS-Zeit und anschließend von den sowjetischen Schergen über viele Jahre gefoltert worden war, einem kleinen Menschen derartiges Leid zufügen? Das Interview finden Sie HIER.

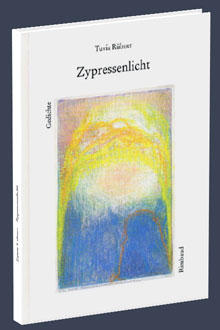
Am hellen Tag
Wo kam ich hin am hellen Tag?
Kam ich hierher am hellen Tag?
Der Mann im Boot schwenkte sein Ruder und setzt
wieder über zum anderen Ufer. Ein Hund hob das linke Bein,
verstreute Reste von Schalen, das Licht ein wenig
zypressenhaft. Ich sprach zu mir. Hierher kam ich,
sprach ich zu mir, und
weshalb kam ich hierher am hellen Tag?
Ein kleines Mädchen, einen Fink in der Hand,
glaubte, sie könne sich drücken. Auch Kinder –
schwenkte sein Ruder und setzt wieder über zum anderen Ufer –
kommen hierher. Wie Schatten bin ich hier im eigenen Herzen
Wie Schatten mein Herz.
Weshalb kam ich hierher am hellen Tag?
(übersetzt von Manfred Winkler)
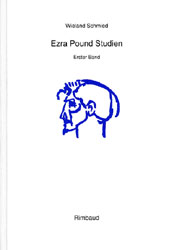
Der Band enthält die Aufsätze:
«Ezra Pound – Größe, Schuld und Tragik eines Dichterlebens»,
«Vortex und Rock drill – Ezra Pound und der Bildhauer Jacob Epstein»,
«Ezra Pound, Wyndham Lewis und der Vortizismus».
… Das neue Büchlein, gedacht als Anfang einer Sammlung der Pound-Studien, bringt drei Arbeiten zum unerschöpflichen Thema. Die erste – ein Vortrag über «Größe, Schuld und Tragik eines Dichterlebens» – bündelt noch einmal Pounds menschliche und politische Problematik. Gegen die Dr.-Jekyll-und-Mr.-Hyde-These, die den Dichter exkulpiert, setzt Schmied den Satz: «Es gibt nur einen Pound»…
Der Vortizismus, zu dessen Wortführern neben Wyndham Lewis und Henri Gaudier-Brzeska Ezra Pound gehörte, verstand sich als Gegenbewegunf zum Futurismus. Gott oder Teufel – gerade bei Pound stecken sie im Detail. Und so bewegt sich der Essayist und Kunsthistoriker Schmied am glücklichsten dort, wo er Phänomene der Poesie und der bildenden Kunst zusammen schauen kann …
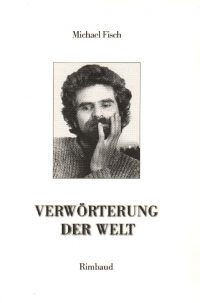
Die vorliegende Arbeit soll neben der Werkinterpretation eines der bedeutendsten deutschen Schriftsteller seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs auch die Analyse eines aufregenden und unsteten Lebens enthalten. Über die Bedeutung des literarischen Grenzgängers Hubert Fichte wird in Fachkreisen kaum mehr gestritten, wenngleich die Bekanntheit seines Werkes noch immer nicht vorausgesetzt werden kann.
Die vorliegende Arbeit bietet die Darstellung eines Schriftstellerlebens und die Analyse eines Schriftstellerwerks. Sie ist in den Kontext der bestehenden Literaturwissenschaft eingebettet und im streitbaren Verhältnis zur institutionalisierten Wissenschaft entstanden. Der Leser dieser Arbeit wird einen erzählenden Ton bemerken, der im Kontrast zum allgemeinüblichen Ton einer allgemeinüblichen philologischen Arbeit steht. Der Verfasser dieser Arbeit bemüht sich, seine Position als Literaturwissenschaftler möglichst wenig von der des Lesers zu entfernen.