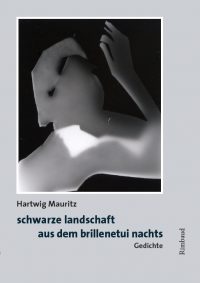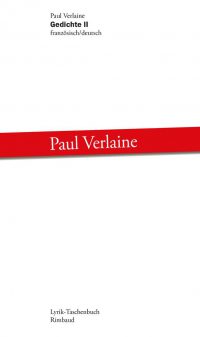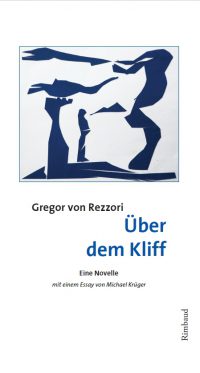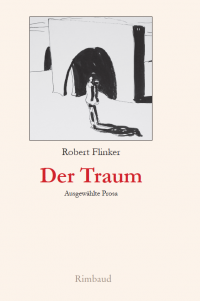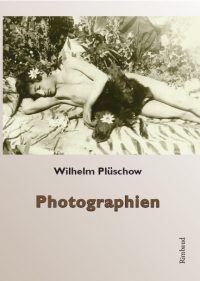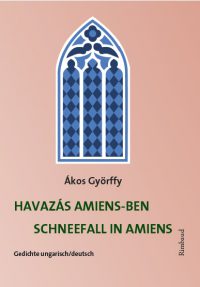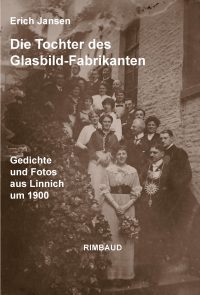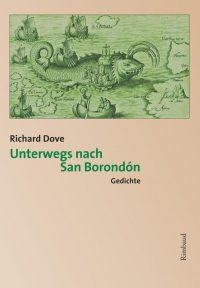hochauflösendes fernweh
nipkow teilt seine eltern in linien, zeilen, punkte, setzt licht
in den draht, baut weiter an morses apparat. dreißigzeilig
tastet sie die eltern ab, die drehende scheibe. weihnachten
1883. die augenbrauen hoch aufgeschossen schneidet sie
vom gesicht. die nase, der mund, das kinn kippt, fällt ins bild
der empfänger zieht schatten in punkten heran. die eltern
sitzen an der scheibe traurigen rändern kreisen die augen
werden von farben nicht satt. die eingabe, die ausgabe birgt
lücken im rhythmus laufen die achsen, die augen saugen
den schattenriss an. portraits wachsen, verlöschen in nipkows
gesicht. ihr bestand verwirrt seinen blick. nipkow
kürzt entfernungen, wenn die scheibe seine iris fixiert.