Meine liebe Frau Ratjen
…Grüße auch an Wolfi
Briefwechsel
Rose Ausländer
Ursula und Wolfgang Ratjen
Herausgegeben von Helmut Braun
320 S., Erstauflage 1997
Übernahme Rose-Ausländer-Stiftung
Autor:
Ausländer, Rose
Meine liebe Frau Ratjen
…Grüße auch an Wolfi
Briefwechsel
Rose Ausländer
Ursula und Wolfgang Ratjen
Herausgegeben von Helmut Braun
320 S., Erstauflage 1997
Übernahme Rose-Ausländer-Stiftung
Neue Erkenntnisse zur Biografie sind gewonnen, gelegentliche Korrekturen angebracht, für manches Bekannte finden sich ergänzende Bestätigungen. Die kreative Arbeitsweise unter oft schwierigsten Bedingungen wird anschaulich nachvollziehbar, die Offenheit für Anregungen und konstruktive Kritik dokumentiert.
Den Briefwechsel ergänzen ein ausführlicher Aufsatz zur Biografie der Dichterin und Anmerkungen des Herausgebers, sowie ein Text von Wolfgang Ratjen zu Ursula Ratjen und ihrer Freundschaft mit Rose Ausländer. Faksimiles von Briefen und Gedichten, sowie mehrere Fotos runden den Band ab.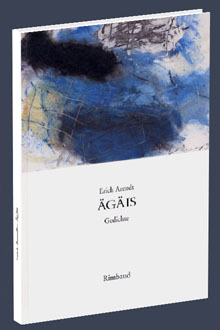
Autor:
Arendt, Erich
Gedichte (1967)
(Sämtliche Gedichte Bd. 6)
hrsg. von Gerhard Wolf
128 S., geb., 1995
Der Gedichtband «Ägäis» erschien 1967 im Insel Verlag Leipzig. Arendt setzte das Erlebnis griechischer Inselwelt, die er in einem Bildband kulturhistorisch beschrieben und mit der Kamera eindrucksvoll festgehalten hat, in große poetische Visionen um. Er hat sechs Jahre an diesem Gedichtband gearbeitet. Hiermit liegt der erste Band der Edition des lyrischen Gesamtwerks Erich Arendts vor.
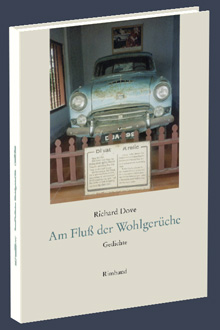
Autor:
Dove, Richard
Gedichte
48 S., geb., 2008
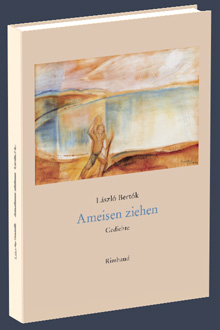
Autor:
Bertók, László
Gedichte
124 S., geb., 2010

Autor:
Neumann, Gerhard
Gedichte
63 S., geb., 1994
Gerhard Neumann galt in den fünfziger Jahren als eine der wichtigsten lyrischen Stimmen der jüngeren Generation. Die neue Tonlage in Neumanns Lyrik kommt in dem Gedicht «Im Mal der Tiere» vielleicht am stärksten und eigenwilligsten zum Ausdruck. Ein Geflecht aus Chiffren und Zeichen, dessen Faszinationskraft sich aus den souveränen sprachlichen Setzungen speist, ein sensibler Leser wird sich wohl kaum diesen Gedichten entziehen können.
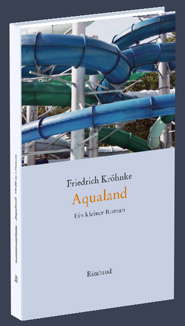
Autor:
Kröhnke, Friedrich
Ein kleiner Roman
Neuauflage (früher Ammann Verlag)
144 S., geb., 2010
"Allein die kunstvolle Konstruktion, in der die Zeitebenen, Orte und Perspektiven in einen gemeinsamen Fluß geraten, ist die Lektüre wert. Kröhnke beweist, daß man mit modernen Mitteln durchaus eingängig und spannend erzählen kann."
- Stefan Sprang, Deutschlandradio
"Einfach ein schönes Buch"
- Burkhard Scherer, FAZ
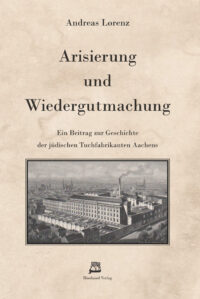
Von Andreas Lorenz
Ein Beitrag zur Geschichte der jüdischen Tuchfabrikanten Aachens
300 S., fadengeheftet, Halbleineneinband, 2023
Die Bedeutung der jüdischen Tuchfabriken wurde in der Geschichte der Aachener Tuchindustrie nicht explizit thematisiert, was als Zeichen einer gelungenen Integration verstanden werden kann. Im Jahr 1938 setzte mit der Erfassung jüdischer Vermögen eine neue Phase der Diskriminierung ein, die mit dem Novemberpogrom einen brutalen Schritt zur Verfolgung und Vernichtung jüdischer Existenzen vollzog. Eine Flucht konnte nur durch Arisierung und Zurücklassung des Vermögens erkauft werden. – Nach dem Krieg wurden die Verbrechen der NS-Zeit zwar öffentlich, aber der Kampf mit den Verwüstungen des Krieges war ein drängenderes Problem. Überlebende oder deren Angehörige glaubten ihr geraubtes Eigentum zurückfordern zu können, was durch das Wiedergutmachungsamt geregelt werden sollte. Doch man bestand darauf, dass es sich um ganz reguläre Verkäufe gehandelt habe und nicht von „Arisierung“ gesprochen werden dürfe.
Für ein mehr als nur oberflächliches Verständnis der Aachener Wirtschaftsgeschichte ist es wichtig, die Bedingungen des Wandels dieser von internationalen Beziehungen und Moden abhängigen Branche zu verstehen. Die bemerkenswerten Erfolge jüdischer Tuchgrossisten und Tuchfabriken und ihre fehlende Berücksichtigung in der Geschichte der Aachener Tuchindustrie sind ein blinder Fleck, der im vorliegenden Band mit Familien- und damit verbundenen Unternehmensgeschichten näher beleuchtet wird.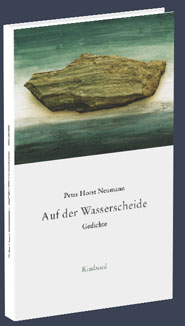
Autor:
Neumann, Peter Horst
Gedichte
112 S., geb., 2003

Autor:
Meister, Ernst
Gedichte
Supplementband 2
Nachwort von Reinhard Kiefer
Mit einem alphabetischen Verzeichnis aller Überschriften und Gedichtanfänge der «Gesammelten Gedichte» zusammengestellt von Martin Linnhoff.
100 S., brosch., 2007

Autor:
Kiefer, Reinhard
gedichte
95 S., geb., 1990

Autor:
Weßlowski, Hans
Gedichte
44 S., brosch., 1996
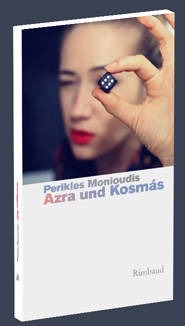
Autor:
Monioudis, Perikles
96 Seiten
Klappenbroschur, 2019.
Kosmás Groß, ein Schriftsteller mit beträchtlichem Bekanntheitsgrad und ebenso großer Öffentlichkeitsscheu, verunfallt in einer Frostnacht in Berlin. Er zieht sich nach Lesbos zurück, wo sein Großvater mütterlicherseits sein Haus hatte und wo er schon als Kind öfter den Sommer verbrachte. Er frönt zunächst seiner großen Leidenschaft, dem Backgammon, und nimmt, mit den Schicksalen der in Nussschalen über die Ägäis Geflüchteten konfrontiert, den Schleppern beim Backgammon das Geld ab, um es den Geflüchteten zurückzugeben. Dabei lichtet ihn ein Wärter ab – und er fliegt vor der Weltöffentlichkeit auf.
Azra, Berliner Ärztin und freiwillige Helferin auf Lesbos, ist von Anfang an präsent; sie folgt dem flüchtigen Kosmás mit dem Schlauchboot auf die nächste Insel. Ihre neuerliche Begegnung wird von einem fürchterlichen Ereignis überschattet, das über die Menschen dort hereinbricht.
Autor:
Kopf, Joseph
Gedichte
Herausgegeben von Adrian Krug
40 S., fadengeh. Klappenbrosch., 2019
eines
bettlers sternenaussatz das blaue licht seiner füsse der maulbeerbaum seiner stirn weisse tiere rings um beershevafrau martita jöhr zu weihnachten 1963
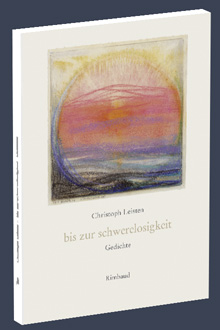
Autor:
Leisten, Christoph
Gedichte
64 S., fadengeh. Brosch., 2010
Die hier versammelten Gedichte setzen im Raum der Wahrnehmung an, um in poetischen Bewegungen des Unterwegsseins die Schwebe auszuloten zwischen alter Geschichte und Jetztzeit, Orient und Okzident, Werden und Vergehen.
DER HIMMEL war heute so blau, als wollte der winter eine pause einlegen für diesen tag, da man sich entschließen könnte, auf eine insel zu fliegen, um in ewigkeit dort zu bleiben. wie seltsam, dass wir immer ein ende vor augen haben beim gedanken an ewigkeit, und so starrten wir ins erdreich am heutigen tag, wo wir ein ende zu sehen glaubten, während, mag sein, ein anderer anfang sich längst schon über uns erhob, flügelleicht, leise und unbemerkt, um uns im blau des himmels zu überfliegen, reif für den sommer seiner insel.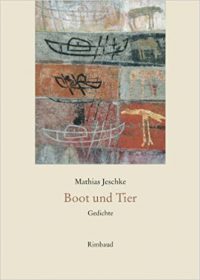
Von Mathias Jeschke
Gedichte
64 S., broschiert, 1999
Mathias Jeschke, geboren 1963 in Lüneburg, aufgewachsen in der Lüneburger Heide. Er studierte Theologie in Göttingen, Heidelberg und Rostock. Seit 1999 lebt er in Stuttgart und arbeitet dort als Verlagslektor. Für seine literarische Arbeit erhielt er ein Stipendium des Landes Mecklenburg-Vorpommern und den Würth-Literatur-Preis.

Autor:
Gorostiza, José
Gedichte (spanisch / deutsch)
(Werke Bd. II, übersetzt von Curt Meyer-Clason,
hrsg., mit Anmerkungen und einem Nachwort von Alberto Perez-Amador)
1 Abb., 144 S., geb., 1999
Mit diesem 2. Band ist die Werkausgabe der ersten deutschen Übersetzung der Lyrik José Gorostizas abgeschlossen. Nichts ist weniger unschuldig als Gorostizas Jugendlieder, die von einer naiven Kritik als eine instinktive Antwort seiner Sensibilität auf die Herausforderungen der Welt gedeutet wurden. Instinktiv oder auch nicht – und ich glaube vor allem an den Instinkt des Dichters, ein Instinkt, der die Erfahrung bereits in sich trägt – ist Gorostizas Jugendwerk nicht weniger komplex als sein Spätwerk. Die Vieldeutigkeit seiner ersten Gedichte unterscheidet sich in nichts von der seines Buches «Muerte sin fin» [«Endloser Tod»]: es handelt sich um dieselbe bestürzende Transparenz. Sie gewährt uns einen Blick auf das, was sich auf der anderen Seite des Spiegels befindet: der Tod, der sich in uns betrachtet.

Autor:
U Tam’si, Tchicaya
Gedichte (französisch / deutsch)
(Werke Bd. I)
hrsg. und mit einem Nachwort von Hans-Jürgen Heinrichs
1 Abb., 96 S., geb., 1993
Tchicaya U Tam’si (1931–1988) ist der Dichter, der «uns aufrührt», «ein Mann des Traums und der Leidenschaft» (hatte Senghor im Vorwort zu «Epitomé» geschrieben). «Er ist für Schwarzafrika, was Pablo Neruda für Lateinamerika ist … der Vater unseres Traums» (Sony Labou Tansi); kompromißlos, auffällig in seiner Erscheinung, mit einer holprigen, ungeglätteten Stimme. In seiner Dichtung «röchelt, lacht, murrt und wettert er» (J. Rancourt). Seine Literatur ist eine, die die Zirkulation des Blutes und die Seele in Erregung vorführt (Obenga) – «le nouveau barbare», wie man ihn verschiedentlich voller Hochachtung genannt hat. Die vorliegende Werkausgabe ist die erste deutsche Übersetzung der Lyrik Tchicaya U Tam’sis.
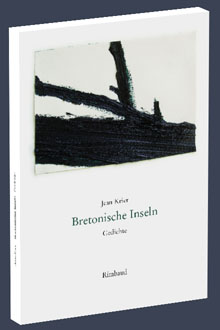
Autor:
Krier, Jean
Gedichte
120 S., brosch., 2006
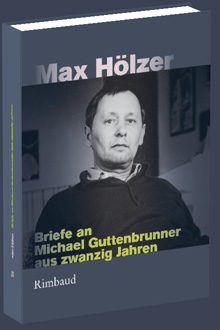
Autor:
Hölzer, Max , Schablewski, Frank ,
1952–1972
Kommentiert von Frank Schablewski
Transkribiert von Karin Dosch
Vorwort und Nachwort von Bernhard Albers
240 S., geb., 2012
Die intensive Beschäftigung mit dem deutschen Surrealismus führte zum informellen Maler und Dichter K. O. Götz (*1914), mit dem ich viele Jahre intensiv zusammengearbeitet habe, schließlich zu Michael Guttenbrunner (1919–2004), dem Adressaten der vorliegenden Briefe. Diese sind das Dokument einer für Max Hölzer einzigartigen Freundschaft, die er in zwanzig Jahren nicht müde wurde, durch romantische Schlussfloskeln zu bekräftigen. Allmählich versiegte der Briefwechsel, weil sich beide offensichtlich in die Einsamkeit Ihrer Dichtung zurückgezogen hatten. Besonders bei Hölzer war es schwierig, eine Adresse zu ermitteln. Augenscheinlich hatte er sich in den letzten Lebensjahren ganz aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Am 22.2.1989 schrieb ich an Brigitte Hölzer: «Ich habe große Mühe gehabt, Ihre Anschrift zu bekommen und nichts unversucht gelassen; bin nun aber froh, mit Ihnen telefoniert zu haben.» Fünf Jahre nach Max Hölzers Tod, konnte ich schließlich mit seiner Witwe, einen Vertrag auf Sämtliche Gedichte ausfertigen. Der hohe Aussagewert der Briefe beruht darauf, daß sie nicht für die Öffentlichkeit, ja mehr noch, gegen sie, genauer, gegen die «Mittelmäßigkeit» des Literaturbetriebes geschrieben wurden: «Ich glaube, daß auch die deutsche Sprache, nicht nur das Volk verflucht ist.» (22.8.1952) «Wer kann von all dem eine Ahnung haben? Sicher kein Literat.» (5.1.1953) Bernhard Albers
Büchner-Studien I
von Theo Buck
112 S., geb., 1990
Modellanalysen zu Danton’s Tod Büchners revolutionäres Menschenbild – Marion oder Die Grammatik einer neuen Liebe – Lucile oder «Die Majestät des Absurden» Büchners Innovation des Dramas – Zur Dramaturgie der Simultanszene

Büchner-Studien II
von Theo Buck
188 S., geb., 2000
Die Reihe ist mit Band II abgeschlossen.
Nachdem im 1990 veröffentlichten ersten Band («Charaktere, Gestalten») insbesondere das revolutionäre Menschenbild untersucht wurde, konzentriert sich dieser davon unabhängige zweite stärker auf den illusionslosen Charakter der Büchnerschen Darstellung der Wirklichkeit.

von Theo Buck
Anmerkungen zu Georg Büchners Marion-Figur
4 Abb., 31 S., fadengeh. Brosch., 1986
Büchners Liebesutopie verstößt nicht nur gegen Tabus, sie überschreitet die Grenzen subjektiver Vereinzelung, schafft Freiräume für die Lebendigkeit und Beweglichkeit partnerschaftlicher Begegnung, die das bloß Individuelle hinter sich läßt. Der Radikaldemokrat Büchner wußte, daß revolutionäre Veränderung neben der Aufhebung sozialer Unterdrückung und Ausbeutung auch die Beseitigung der «sexuellen Zwangswirtschaft» voraussetzt. Darum skizzierte er in «Danton’s Tod» mit der Marion-Figur die Grammatik einer neuen Liebe.

Autor:
Bergel, Hans
Von Dichtern und bildenden Künstlern
(Studien zur Literaturgeschichte Bd. 3)
96 S., fadengeh. Brosch., 2002
Die in unseren Tagen vieldiskutierte Literaturlandschaft der Bukowina – des Buchenlandes, wie ihre deutschschreibenden Dichter sie vorzugsweise nennen – lebt selbstverständlich zunächst aus dem schöpferischen Impetus ihrer poetischen Begabungen von Paul Celan bis Gregor von Rezzori, von Rose Ausländer bis Dorothea Sella, von Moses Rosenkranz und Manfred Winkler bis Georg von Drozdowski und den anderen. Sie alle sind bei näherem Hinsehen aber nicht allein Kinder ihrer Heimatprovinz Bukowina, sie sind gleichzeitig eingebunden ins mehrschichtige Kulturengeflecht weiter gespannter südosteuropäischer Räume.
Aus dem Inhalt: Aus Bukarester Tagen nach dem Zweiten Weltkrieg, Erinnerungen an Alfred Margul-Sperber. «Von den Schultern der Karpaten …», Deutschschreibende jüdische Autoren aus Südosteuropa in Israel. «Nichts war vergangen, alles war in mir», Gedenkblatt für Gregor von Rezzori. Unverwechselbarkeit dichterischer Sprache, Moses Rosenkranz’ lyrische Jahrhundertbekundungen. «Die Liebe zur deutschen Sprache …», Der israelische Dichter Manfred Winkler. Aus Pannonien über Afrika in die Judäische Wüste, Oswald Adler – der Maler, Graphiker, Lehrer und Essayist. Der Skulpturenkosmos in der Messilat Yescharim, Der Lyriker Manfred Winkler als Bildhauer.
Autor:
U Tam’si, Tchicaya
Gedichte (französisch / deutsch)
(Werke Bd. II)
hrsg. und mit einem Nachwort von Hans-Jürgen Heinrichs
192 S., geb., 1997
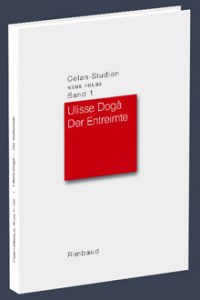
Autor:
Celan, Paul
Celan-Studien. Neue Folge. Bd. 1
von Ulisse Dogà
Über Paul Celans Spätwerk
144 S., geb., 2007
Besonders in der Spätlyrik dringt Celan in eine Sprache ein, die immer mehr ausdünnt, aber paradoxerweise auch ungeheuerlich dicht und reich ist. Wie gesehen, gibt es in dieser «orphischen» Dichtung kein Zurück und keine Wiedergeburt, keine Heimat und keine Hoffnung, doch tritt in der Darstellung des Scheiterns der poetischen Aufgabe ein Wort, eine Mitteilung, eine Gabe, die eigentlich ein schwieriges Erbe ist, zu Tage. Die von Celan ist eine Passionssprache als erlittene und im Text sedimentierte Gewalt, in der «der Sinn einer Trennung, eines Kreischens, eines von einer ganzen Kultur gegen den Dichter begangenen Verrats bleibt. Celan hat alles versucht, um sich über die absolute Verzweiflung zu erheben, aber er ist dabei umgekommen. Es bleibt eine Trennung im Herzen der deutschen und europäischen Kultur, eine Spaltung, die leider noch heute, in der Zeit eines neuen menschlichen Zusammenlebens, die untrüglichen Spuren eines Schattens wirft.»
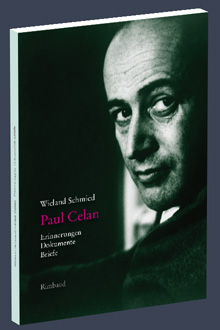
Autor:
Celan, Paul
Celan-Studien. Neue Folge. Bd. 4
von Wieland Schmied
64 S., fadengeh. Brosch., 2010
Die hier gewiß nur bruchstückhaft mögliche Darlegung der Bedingungen, die Paul Celans Dasein prägten, soll in etwa das Wissen skizzieren, das ich damals besaß, als ich Celan zum ersten Mal traf. Denn nur wenn verständlich ist, was ich von Celan, seinem dichterischen Werk und den Anfeindungen, denen er ausgesetzt war, wußte, wird die Situation nachvollziehbar, in welcher sich die Begegnung seinerzeit abgespielt hat.

Autor:
Celan, Paul
Celan-Studien. Neue Folge. Bd. 5
von Andrei Corbea-Hoisie
Sein erstes Jahrzehnt in Paris
130 S., geb. fadengeh., 2. Aufl. 2017
Inhalt: Einleitung Paul Celan Student an der Sorbonne Paul Celan – vom «Staatenlosen» zum französischen Staatsbürger Im französischen Hochschuldienst Schmuggelware. Zur «biographischen» Wende in der Celan-Forschung Zwei Frauen Germanistische Mitteilungen veröffentlicht in Nummer 44.2 (2018) eine Rezension von Jan Roelans
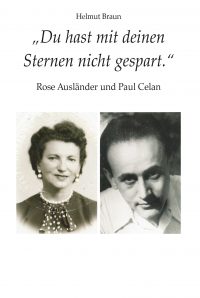
Autor:
Celan, Paul
Von Helmut Braun
Rose Ausländer und Paul Celan
(Celan-Studien. Neue Folge. Bd. 7)
127 S., broschiert, Fadenheftung, 2021
Im umfangreichen Nachlass von Rose Ausländer finden sich zahlreiche Dokumente, Fotos und Texte zu den Begegnungen mit ihrem Landsmann Paul Celan. Auf dieser Basis zeigt Helmut Braun, der Nachlassverwalter der Dichterin, das Verhältnis der Poetin und des Poeten. Beider Leben und Werk ist durch die Shoa gezeichnet. Paul Celan zerbricht am Erlittenen; er geht in den Freitod. Rose Ausländer findet im hohen Alter ihren Frieden: „Ich erwarte nichts, aber ich lebe gern.“
1957, nach der Lektüre von Paul Celans Büchern Mohn und Gedächtnis und Von Schwelle zu Schwelle, notierte Rose Ausländer: „Der Tod hat seinen besten Dichter ins Leben gerufen“.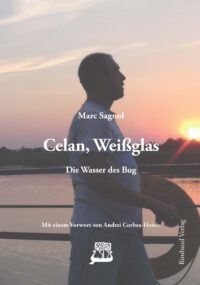
Autor:
Celan, Paul
Von Marc Sagnol
(Celan-Studien. Neue Folge. Bd. 8)
80 S., fadengeheftet, Festeinband, 2024
Für Celan waren Flüsse mehr als topographische Gegebenheiten. Er hatte ein Gespür für ihre beinahe metaphysische Bedeutung, und daher konnte ihn die unheilvolle Wandlung des Südlichen Bug von einer utopischen Landschaft religiöser und literarischer Schöpfung, einer Zufluchts- und Pilgerstätte, in einen Ort der Vernichtung nicht unberührt lassen. Besser als irgendjemand sonst vermochte er dieses Paradoxon und den Schmerz über die Vernichtung des jüdischen Volkes in Regionen, die es mit seinem geistigen Reichtum und seiner Kreativität geprägt hatte, in Worte zu fassen. Flüsse prägten Celans Leben und Werk, die Seine, der Rhein, der Bug oder die Oka. Und auch sein Tod steht im Zeichen eines Flusses, da er seinem Leben in der Seine ein Ende setzte.

Autor:
Celan, Paul
Celan-Studien I
von Theo Buck
1 Abb., 192 S., geb., 1993
Zu einem der bedeutensten deutschsprachigen Lyriker nach 1945 werden fünf Abhandlungen vorgelegt. Die ersten beiden stellen ein Strukturbild von Celans Leben und Werk sowie einen Essay zu seinem Judentum dar. Daran schließen sich exemplarische Interpretationen zur Entwicklung seiner Lyrik am Beispiel dreier Schlüsselgedichte an: «Todesfuge» (1945), «Engführung» (1958), «Du liegst im großen Gelausche…» (1967).
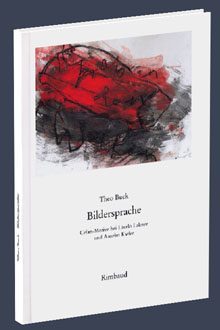
Autor:
Celan, Paul
Celan-Studien II
von Theo Buck
Celan-Motive bei László Lakner und Anselm Kiefer
6 Abb., 52 S., geb., 1993
Wie aus Sprachbildern Bildsprache, also Sprache der Bilder wird, beschreibt dieser Essay am konkreten Beispielfall bildnerischer Reflexe der Celanschen «Todesfuge» im Werk von László Lakner und Anselm Kiefer.

Autor:
Celan, Paul
Celan-Studien III
von Theo Buck
Konstellationen um Celan
5 Abb., 128 S., geb., 1995
Zu einem der bedeutendsten deutschsprachigen Lyriker nach 1945 werden vier Abhandlungen vorgelegt: «Schibboleth» oder Die Identifikation mit dem Spanischen Bürgerkrieg «Am Stiefpol» oder Die Abrechnung mit der kommunistischen Diktatur «Ein Wort mit all seinem Grün» Zu einem lyrisch-poetologischen Dialog Erich Arendts und Ernst Meisters mit Paul Celan Celan übersetzt Picasso

Autor:
Celan, Paul
Celan-Studien IV
von Theo Buck
132 S., geb., 2. Aufl. 2003
Zu einem der bedeutendsten deutschsprachigen Lyriker nach 1945 werden fünf Abhandlungen vorgelegt. Neben drei neuen Gedichtinterpretationen untersucht der Autor die Begegnung Paul Celans mit der Gruppe 47 sowie dessen Übersetzung des Trunkenen Schiffs von Rimbaud: Celan und die Gruppe 47 Celan übersetzt Rimbaud Begegnungen mit van Gogh und Rembrandt – Zum Gedicht «Unter ein Bild» – Zum Gedicht «Einkanter: Rembrandt…» Vom Pathos zu Wortresten – Ein gestischer Paradigmawechsel im Werk am Beispiel des Gedichts «Stückgut»
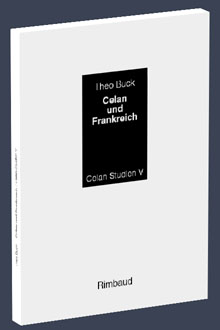
Autor:
Celan, Paul
Celan-Studien V
von Theo Buck
Darstellung mit Interpretationen
62 Abb., 108 S., brosch., 2002
Frankreich war über zwei Jahrzehnte hindurch die Wahlheimat Paul Celans. Im europäischen Mutterland republikanischer Verfassung fand der jüdische Dichter deutscher Sprache aus der Bukowina nach den Erfahrungen des Holocaust einen Ort, wo er leben und arbeiten konnte. Frankreichs Sprache, Landschaften, Kultur und Menschen haben sein Werk in vielfacher Weise mit geprägt. Dadurch ist er tatsächlich zum «größten französischen Dichter deutscher Sprache» geworden, als den ihn der französische Germanist Claude David bezeichnet hat. Aber auch in Paris holte ihn die mörderische Vergangenheit in unterschiedlicher Form wieder ein. Vor allem die ‹Goll-Affäre› in Gestalt ebenso infamer wie absurder Plagiatsvorwürfe durch die Witwe Yvan Golls zerstörte die psychischen Reserven des Dichters in einem Maße, daß seine letzten Lebensjahre zu einer seelischen Hölle wurden. Nach einer Lebensskizze und dem Bericht über Celans ersten Frankreichaufenthalt im Studienjahr 1938–1939 (I) stellt die knappe Schilderung der biographisch wichtigen Zwischenzeit von 1939 bis 1948 mit den schwierigen Schicksalsjahren in Czernowitz und im Arbeitslager, dem Weggang nach Bukarest und dann der Flucht über Wien den Zusammenhang her bis zur Übersiedlung nach Paris (II). Im Zentrum der Darstellung stehen jedoch die Entwicklungen während der 22 Jahre, die Celan in Frankreich verbrachte. Sie gliedern sich in zwei sehr voneinander verschiedene Phasen, wobei das Jahr 1960 als existentielle Zäsur gelten kann. Deshalb gilt ein erster Teil der Betrachtung des schwierigen Anfangs und der zeitweiligen Konsolidierung in Leben und künstlerischer Arbeit (III), während im zweiten Teil der schwierige Kampf zwischen unausweichlichen psychischen Belastungen und literarischem Gestaltungswillen zur Darstellung kommt (IV). Allerdings sollte die Intention des Buches nicht allein in der Klärung biographischer Zusammenhänge gesehen werden. Mit Absicht ergänzen darum fünf ganz vom Text ausgehende Modellanalysen einschlägiger Gedichte («Im Park», «Erinnerung an Frankreich», «Auf Reisen», «Auf hoher See», «Eingejännert») die Ausführungen zu den Lebensumständen. Es handelt sich dabei um Interpretationen dieser poetischen Reflexe zu verschiedenen Punkten der Celanschen Lebensbahn vom ersten persönlichen Kontakt mit Frankreich bis zur nicht mehr lebbaren Endphase. Sie dienen dem wesentlichen Ziel einer Klärung des künstlerischen Weges, den Celan sich mühsam erschlossen hat, indem sie dem Leser Stationen des Weges zeigen zu seinem ganz eigenen Sprachkosmos, der jedoch die existentiellen Probleme und Katastrophen des 20. Jahrhunderts präzise und exemplarisch zur Sprache bringt. […] Zwar vieler europäischer Sprachen mächtig, schien Celan für sein künstlerisches Wollen oder auch Müssen nur das Deutsche geeignet. Dem gefühlten Auftrag zu deutscher Dichtung, zur Übersetzung ins Deutsche, gepaart mit Celans jüdischem Selbstverständnis, aber auch mit der gefühlten Schuld des Überlebenden und pathologischen Ängsten gerade vor Deutschland, in dem er vor allem seine Leser suchte und fand, hielt Celan psychisch letztlich nicht mehr stand. […]

Autor:
Celan, Paul
Celan-Studien VI
von Theo Buck
Interpretationen zur poetischen Konzeption Celans
30 Abb., 148 S., brosch., 2004
«Auf Atemwegen»? Was bedeutet das im Zusammenhang mit dem Werk, das uns Paul Celan hinterlassen hat? Die Formulierung stammt aus einem Gedicht, dessen Eingangsvers lautet: «Ein Wurfholz, auf Atemwegen». Die Anspielung auf die eigentümliche Wurfwaffe der Urbevölkerung Australiens, den Bumerang, der, wenn er sein Ziel verfehlt, zum Werfenden zurückkehrt, darf uns nicht täuschen. Kriegerisches steht hier gewiß nicht zur Frage. Denn der Wortlaut der Folgeverse – «Ein Wurfholz, auf Atemwegen, / so wanderts, das Flügel- / mächtige, das / Wahre» – klärt hinreichend, daß es dem Dichter um den beschreibenden Vergleich einer energischen Flugbewegung geht. Konkreten Einblick in die von Celan eingeschlagenen «Atemwege» wollen die nachfolgenden Interpretationen vermitteln. Es handelt sich dabei durchweg um Texte aus den in den sechziger Jahren zusammengestellten Sammlungen. Interpretationen zu fünf Gedichten aus der Sammlung «Die Niemandsrose» (1963) bilden den ersten Hauptteil. Es folgt im zweiten Teil die Betrachtung von acht Gedichten, die während der einwöchigen Reise Celans durch Südfrankreich 1965 entstanden sind. In zwei kürzeren Kapiteln werden am Schluß zwei Beispieltexte der Jahre 1967 und 1968 aus den postum publizierten Sammlungen «Lichtzwang» und «Schneepart» betrachtet: die Gedichte «Blitzgeschreckt» und «Kalk-Krokus».
Autor:
Celan, Paul
Celan-Studien VII
von Theo Buck
Vergriffen! Out of print!
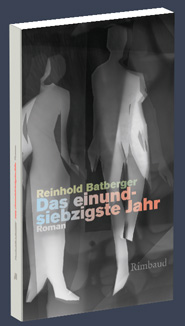
Autor:
Batberger, Reinhold
Roman
144 S., Klappenbrosch., 2019
Heinrich Maria ist einundsiebzig Jahre alt, oh mein Gott! Wollte er nicht Tiermissionar werden? Und jetzt lebt er tatsächlich mit seinen schäbigen Tieren auf einem abgewrackten Flugplatz und unternimmt kleine, grausame Ausflüge. Aber nicht in die Abtei Münsterschwarzach, bitte nicht!
Eben noch im elften Jahr ist Heinrich Maria im einundsiebzigsten Jahr gelandet und auch auf einem ehemaligen Flugplatz. Alex und seine Mutter, die Tierärztin sind bereits auf dem Weg zu Heinrich Maria und den Tieren, ein frisch gebackener Grüßgottkuchen steht auf dem Tisch. Der Schnee ist zwar schon wieder schwarz, nicht aber die Zeit der Erinnerung. Kleine Ausflüge, eine Reise nach Israel, eine Reise nach Rom. Erstaunlicherweise gibt es eine religiöse Hintergrundstrahlung, doch Richie der Gewitterhund warnt vor jeder Art von Unwetter und sei es im Augenblick noch so weit entfernt.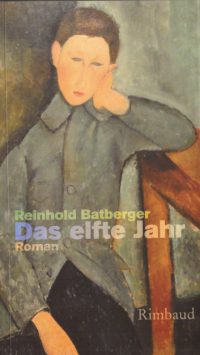
Autor:
Batberger, Reinhold
Roman
280 S., fadengeh. Klappenbrosch., 2017
Für begrenzte Zeit stark ermäßigt
«Das elfte Jahr» ist eine sprachlich variantenreiche Geschichte von Unterordnung, Erziehung und Selbsterziehung, in der zugleich geschickt die Stimmung der Nachkriegszeit zwischen Schweigen und Aufklärung inszeniert wird.
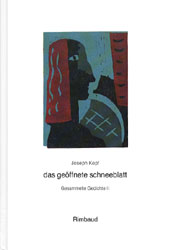
Autor:
Kopf, Joseph
Gesammelte Gedichte Bd. II – 1967–1979
(Hrsg. von Paul Good)
192 S., geb., 1992

Autor:
Rübner, Tuvia
Letzte Gedichte
Mit Nachworten von Frank Schablewski und Matthias Weichelt
215 S, geb. Fadenheftung, 2022
"Was bringt einen Dichter dazu, auch dann weiterzuschreiben, wenn die Verse nur noch mit Mühe ihren Weg aufs Papier finden, jede Silbe Qual und Anstrengung bedeutet? Wenn die Phantasie ihn im Stich lässt, die Bilder ausbleiben? Warum legt er den Stift nicht aus der ungelenkig gewordenen Hand, wo doch alles gesagt zu sein scheint? Für den im Juli 2019 gestorbenen Tuvia Rübner war das Schreiben Lebensimpuls, Ausdruck innerer Erregung kein Entschluss, sondern Notwendigkeit" - Matthias Weichelt

Autor:
Götz, K. O.
Für K. O. Götz zum 80. Geburtstag
7 farbige Abb., 64 S., geb., 1994

Autor:
Götz, K. O.
Für K. O. Götz zum 85. Geburtstag
12 Abb., 64 S., geb., 1999
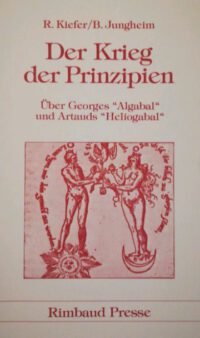
Autor:
George, Stefan
von Brigitt Jungheim und Reinhard Kiefer
Über Georges «Algabal» und Artauds «Heliogabal»
44 S., brosch., 1981
Auch das gesellschaftlich sanktionierte Liebesverhältnis Mann-Frau wird durch das Homosexuelle aller eindeutigen Zweckbestimmung und Verwertbarkeit entrissen und in sich selber begründet und hat so Teil am Ideal. Ausdruck der Mißachtung der Frau, und damit der heterosexuellen Liebe, ist die ausgelassene orgiastische Szene im vierten Gedicht, in der nur Frauen als "dirnen" ihre körperlichen Reize zeigen, bis Algabal dazwischen tritt und das Fest mit den Worten: "Aller ende/Endedasfest!" verkündet, woraufhin der Rosenregen folgt. Die Rosen, als heterosexuelles Liebessymbol, sind von purpurner und weißer Farbe; der Farbsymbolik nach ist das Purpurne, das Rote, die Farbe des Weiblichen, während Weiß die Farbe des Männlichen ist. Beide Pole treten nebeneinander auf, bleiben unverbunden und werden auf ihre Wirksamkeit hin befragt: "liebkosen" sie?, "laben" sie? Doch das ist nicht ihr Grund, sondern sie sollen "segnen" - nicht zum Leben, denn die Rosen sind "Manenküsse", sondern zum Tode. Der Kreis schließt sich, auch die Orgie als freies sexuelles Treiben, findet ihren Abschluß im Tod der Beteiligten. Die Rosen sind wirklich fallende und sind zugleich Symbole der Seinsweisen: Das Zusammentreffen von männlich und weiblich führt nicht zur Erfüllung, sondern zur Vernichtung...
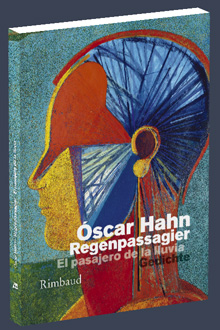
Autor:
Hahn, Óscar
Gedichte
spanisch/deutsch
Aus dem Spanischen ausgewählt und übertragen und mit einem Essay von Walter Eckel
1 Abb., 152 S., Klappenbrosch., 2013
Óscar Hahn, chilenischer Dichter mit deutschen Vorfahren, zählt in der spanischsprachigen Welt zu den bedeutendsten Gegenwartsdichtern. Sein Werk wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem chilenischen Altazor-Preis (2003 und 2012), dem spanischen Literaturpreis Casa de América (2006), dem kubanischen Lezama-Lima-Preis (2008), dem Iberoamerikanischen Poesiepreis Pablo Neruda (2011) und dem Chilenischen Nationalpreis für Literatur (2012). Seine Gedichte wurden ins Englische, Griechische und Italienische übersetzt. Die erste deutschsprachige Ausgabe erschien im Frühjahr 2012 im Rimbaud Verlag unter dem Titel Liebe unter den Ruinen. Sie wurde auf einer Lesereise durch sieben deutsche Städte vorgestellt. Das Interesse an Hahns Gedichten hat den Rimbaud Verlag ermutigt, bereits 2013 einen weiteren zweisprachigen Band unter dem Titel Der Regenpassagier zu veröffentlichen. Dieser enthält eine Auswahl von 50 Gedichten, die aus sechs Sammlungen von 1981 bis 2011 stammen. Hahns Werk kreist seit seinen Anfängen als Dichter um die Themen Liebe, Tod, Vergänglichkeit, Krieg, Literatur, Kunst, Musik, Philosophie, Psychologie, Erotismus und das Fantastische. Im Unterschied zu Liebe unter den Ruinen liegt im Regenpassagier ein stärkeres Gewicht auf Gedichten, die nach seiner Rückkehr nach Chile – Hahn lebte von 1974 bis 2008 in den Vereinigten Staaten – entstanden sind. Nachdem das deutsche Lyrikpublikum im ersten Band in einer Werkeinführung mit der Dichtung Hahns vertraut gemacht worden war, steht am Anfang dieser Sammlung ein Essay, der Verbindungslinien zwischen dem Werk und der Person des Dichters aufzuzeigen sucht.
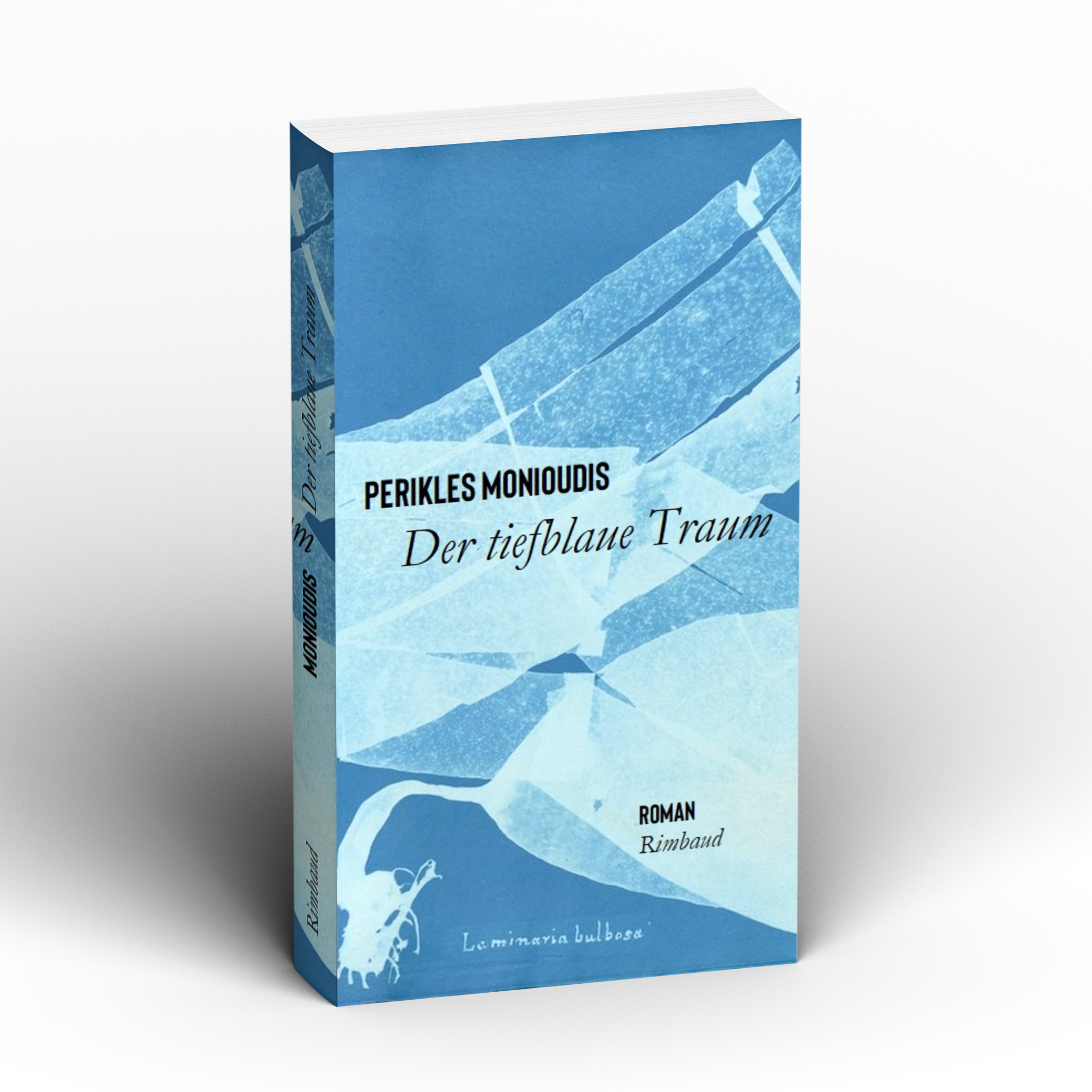
Autor:
Monioudis, Perikles
Roman
312 S., broschiert, 2024
Ein Liebesroman, ein Unternehmerroman: Die Kunst hat ihren großen Platz in diesem klug erzählten, beziehungsreichen Roman, dessen Handlung in Zürich, Berlin, Boston und in China angesiedelt ist. Ein junger Mann und eine junge Frau, Aimée, Tochter eines bekannten Kunstmalers, ziehen am Ende der 1980er-Jahre einen florierenden Computerhandel mit PC-Clones aus Fernost auf. Sie betreiben den Handel nach den Regeln des Handwerks, verkaufen ihre Ladenkette dann aber doch, um Kunst zu sammeln und die bedeutende Privatsammlung des Kunstmalers zu betreuen. Die beiden gehen später fest davon aus, dass die Maschinen in hundert Jahren alles übernommen haben werden und die einzige Möglichkeit, etwas Menschliches hinüberzuretten, darin besteht, jetzt Kunst zu sammeln, die nicht maschinenlesbar ist. Kunst also, die auch von den Künstlern selbst nicht verstanden wird – so wie die Liebe.
Ein hinreißender Roman über sich wandelnde Haptik, sich verändernde Träume und die stete Suche nach dem Eigentlichen.-Sascha Dederichs
"Perikles Monioudis gehört zu den wenigen zeitgenössischen Autoren, deren Werk von der beharrlichen Entwicklung einer originären Poetik zeugt."-Neue Zürcher Zeitung
"Eine solch gute Geschichte lesen wir jetzt wieder im neuen Roman von Perikles Monioudis – ‹Der tiefblaue Traum›, so heißt das Buch.»"-Joachim Scholl, Deutschlandfunk
"Indem Monioudis Kunst und Technik aufeinanderprallen lässt, entsteht eine surreale Wirkung, die durch das immer wiederkehrende Motiv des Traums verstärkt wird. Und genau in diesen surrealen Momenten liegt die Stärke dieses Romans. So schafft er – wie der Titel bereits andeutet – selbst ein ästhetisches Erleben, das sich der maschinellen Vermittlung entzieht."-Luana Sarbacher, Schweizer Buchjahr

Autor:
Koch, Alice
Traumerzählungen
Mit einem Nachwort von Hans Bender
93 S., geb., 1988
«Alice Koch hat die natürliche Gabe zu schreiben, zu berichten zu vermitteln. Ihre Sprache muß sich nicht anstrengen, weil die authentischen Träume selber vorsagen, welche Wörter und Sätze zu wählen sind. Zusätzliches Interesse wecken die Traumprotokolle, wenn man weiß: Alice Koch/Else Meister war die Ehefrau und Lebensgefährtin von Ernst Meister. Sie hat ihn und sein Werk inspiriert. Da und dort glaubt man die Nähe zu ihm, dem einzigartigen Dichter, in ihnen zu erkennen.»
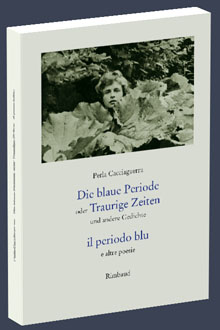
Autor:
Cacciaguerra, Perla
italienisch / deutsch
übersetzt von Annette Vogelgesang
200 S., Klappenbrosch., 2005
Nach dem Krieg arbeitete Cacciaguerra für den Minister Rodolfo Siviero in Florenz, dessen Aufgabe es war, Kunstschätze, die als Beutegut nach Deutschland geschafft worden waren, in ihr Land zurückzuführen. Später in Rom arbeitete sie für die Fulbright Foundation und schließlich ein Jahr für die UNO in Genf. Sie hat früh zu schreiben begonnen, ihr Kriegstagebuch stammt aus den Jahren 1943–1945 (ibiscos Editore). Danach wendet sie sich der Poesie zu. Zwischen 1951 und 2000 erscheinen zahlreiche Gedichtsammlungen, Prosabände und ein Theaterstück, die mit diversen Literaturpreisen ausgezeichnet wurden. Sie hat auch aus dem Amerikanischen übersetzt: für Mondadori die «Antologia di poeti negri d'America», in Zusammenarbeit mit Leone Piccioni, «Per amore» von Robert Creeley und «La scuola di New York»; für Guanda die Gedichte von Jude Stefan und für den «Almanacco dello specchio» einige Gedichte von Philip Larkin. Für die RAI hat sie mehrere Hörspiele geschrieben. 1996 wurden an der East Carolina University vier Kompositionen von Brett Watson nach Texten von Perla Cacciaguerra uraufgeführt.
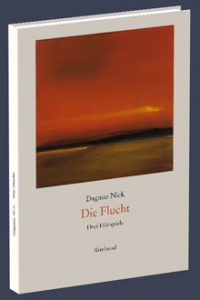
Autor:
Nick, Dagmar
Drei Hörspiele
Mit einem Nachwort von Jürgen Nelles
108 S., geb., 2. Aufl. 2017
Die Flucht, 1958
Das Verhör, 1961 Requiem für zwei Sprecher und Chor, 1970
Gedichte / Ποιήματα
zweisprachige Ausgabe deutsch / griechisch
ins Griechische übertragen von Perikles-Aias Konstantinidis
μετάφραση από τα γερμανικά Περικλής-Αίας Κωνσταντινίδης
144 S., brosch., 2001
Ο Έρνστ Μάϊστερ, γεννήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίουτου 1911 στην πόλη Hagen-Haspe της Βεστφαλίας και πέθανε στην πατρίδα του στις 15 Ιουλίου 1979. Ήταν μέλος του PEN και της Γερμανικής ακαδημίας για την Γλώσσα και την Ποίηση η οποία το Φθινόπωρο του 1979 του απένειμε το βραβείο Georg Büchner σαν «μετά θάνατoν» αναγνώριση τoυ πoιητικoύ τoυ έργoυ.
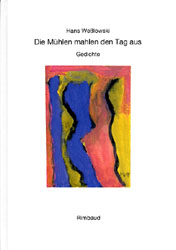
Autor:
Weßlowski, Hans
Gedichte
64 S., geb., 1998

Autor:
Jansen, Erich
Lyrik und Prosa (1968)
123 S., geb., 1987
Grenzstadt in der Dämmerung
Ich sah die Toten in ihren Blechgewändern von den Türmen herabsteigen. Ich hörte die Glocken, gelb, aus Abendmessing und Fledermausangst, und die Häuser bewegten sich nicht. Und der Bischof vom Platz verzeichnete alles in den Annalen.
Autor:
Vallejo, César
Gedichte (spanisch / deutsch)
Werke Bd. IV, übersetzt von Curt Meyer-Clason,
hrsg., mit Anmerkungen und einem Nachwort von Alberto Perez-Amador
1 Abb., 176 S., geb., m. Lesebändchen, 2000
Vallejo war ein großer religiöser Dichter. Obgleich militanter Kommunist, bildete den Hintergrund seiner Lebensauffassung und seiner Glaubensüberzeugungen nicht die kritische Philosophie des Marxismus, sondern die Grundmysterien des Christentums seiner Kindheit und seines Volkes: die Kommunion, die Transsubstanziation, die Sehnsucht nach Unsterblichkeit. Seine Wortschöpfungen beeindrucken uns nicht allein durch ihre ungewöhnliche innere Sammlung, sondern vor allem durch ihre Echtheit.
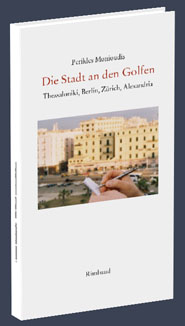
Autor:
Monioudis, Perikles
Thessaloniki, Berlin, Zürich, Alexandria
Nachwort Ingo Schulze
96 S., geb. mit Lesebändchen, 2004
In Monioudis’ «stiller, zurückhaltender und intensiver Prosa» (Süddeutsche Zeitung) erleben wir vier Städte: Ein Mann und eine Frau gehen durch Alexandria im Orient und Thessaloniki am Fuß des Balkangebirges, durch Berlin mit seinem kontinentalen Klima, durch Zürich, gelegen zwischen Seen und Alpen.
«Monioudis hat den von Phantasmen und Klischees freien Blick auf Alexandria. Er sieht Dinge, die jeder im Nahen Osten sehen könnte – und doch nicht sieht.»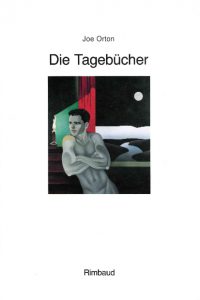
Autor:
Orton, Joe
sowie der Briefwechsel von Edna Welthorpe etc.
ediert von John Lahr
übersetzt von Anette Bretschneider und Sabine Griesbach
44 Abb., 392 S., geb., 1995
The Orton Diaries (Hrsg. John Lahr) wurden 1986 erstmals veröffentlicht.
Aus dem Vorwort: "Ich habe aus den Londoner Orton-Tagebüchern fast nur das gekürzt, was zur Vermeidung von Verleumdungsklagen nötig war. Aus dem Tanger-Tagebuch wurden einige Wiederholungen gestrichen. Einige Namen wurden aus rechtlichen Gründen geändert. Ansonsten gehen wir davon aus, daß die Tagebücher so sind, wie sie am Tage des Mordes von der Polizei auf dem Schreibtisch von Orton gefunden wurden. [...] Noch immer sind die Tagebücher von Geheimnissen umgeben. Halliwells Abschiedsbrief besagt, daß die Tagebücher - hauptsächlich der letzte Teil - alles erklären werden. Sie tun es nicht, jedenfalls nicht eindeutig. So wie sie von Orton geschrieben wurden, enden die Tagebücher mit einem Bindestrich: abgeschnitten, wie auch Orton, in vollem Schwung. Für jemanden, der so konsequent schrieb wie Orton, erscheint mir dies recht unwahrscheinlich. Die Tagebücher enden am 1. August 1967. Orton starb am 9. August."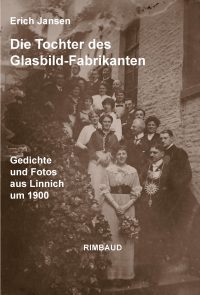
Autor:
Jansen, Erich
Gedichte und Fotos aus Linnich um 1900
Hrsg. von Adrian Krug
Die Texte haben einen Bezug zur Stadt Linnich und der dort beheimateten Familie der ‘Glasfabrik’.
Der vorliegende Band wird ergänzt durch historische Fotographien der Stadt und der Familie Oidtmann, den ‘Glasfabrikanten’. Aus ihrem privaten Familienalbum ist auch die hier vorliegende Abbildung entnommen.
29 S., Fadenheftung, Klappenbroschur, 2021
Die Tochter des Glasbild-Fabrikanten
Immer in der Nacht, wenn sie in weißer Seide über das mondne Katzenkopfpflaster des Innenhofs schreitet und alle Uhren im Hause verstummen, ziehen dreißig Künstler ihre schwarzen Tellerhüte und malen ihr Bild in die Madonnen ihrer Glasfenster; breitwangig, mit dem Duft hellweißer Oblaten; die Augen aber, in Malvenwasser gebadet, innen ganz blau, und die Arme malen sie rund, französisch kalt, wie auch die Nächte sind, wenn sie im weißen Kleid den Innenhof durchschreitet und zurückschaut. Sie sieht nicht, wie am Apfelbaum das violette Blut entlangläuft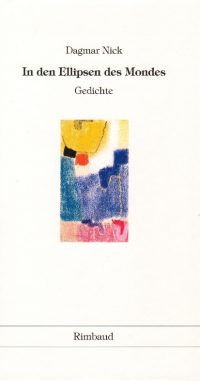
Autor:
Nick, Dagmar
Gedichte (1945–1959)
(Gedichte Bd. 1)
64 S., geb., 1994

Autor:
Nick, Dagmar
Gedichte (1969)
(Gedichte Bd. 2)
63 S., geb., 1990
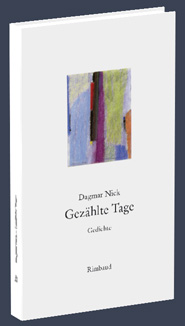
Autor:
Nick, Dagmar
Gedichte (1986)
(Gedichte Bd. 3)
63 S., geb., 2. Aufl. 2010
«Das Erstaunliche dieser Lyrik ist die gelassene Beherrschung der Sprache, die gebändigte Leidenschaft, der Geist gewordene Eros. In dieser Lyrik gibt es keine falschen Töne, keine abgegriffenen Metaphern, keine leeren Worthülsen.»
Autor:
Nick, Dagmar
Gedichte
(Gedichte Bd. 4)
63 S., geb., 1991

Autor:
Nick, Dagmar
Gedichte (1991–1995)
(Gedichte Bd. 5)
64 S., geb., 1996

Autor:
Barth, Emil
Essay
Zum Gedächtnis seines fünfzigsten Geburtstages am 3. Februar 1937
(Gesammelte Werke Bd. 1)
48 S., brosch., 2001

Autor:
Barth, Emil
Roman (1939)
(Gesammelte Werke Bd. 3)
236 S., fadengeh. Brosch., 2000
«Der Wandelstern» ist kein trauriges, eher ein offenbarendes Buch, dem Wilhelm Hausenstein in der Frankfurter Zeitung, kurz nach Barths Tod, eine «Art von Vollkommenheit» nachrühmte.

Autor:
Barth, Emil
Aufzeichnungen und Meditationen aus den Jahren 1943–1945 (1947)
(Gesammelte Werke Bd. 4)
247 S., geb., 1997
Bei «Lemuria» handelt es sich um das Tagebuch eines Außenseiters und Pazifisten aus den letzten Jahren des 2. Weltkrieges, das hier fünfzig Jahre nach seiner Erstpublikation wieder aufgelegt wird.

Autor:
Barth, Emil
Erzählung (1951)
(Gesammelte Werke Bd. 5)
62 S., geb., 1990
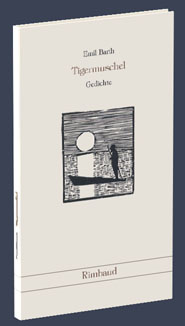
Autor:
Barth, Emil
Gedichte (1956)
Mit einem Nachwort von Karl Ruhrberg
(Gesammelte Werke Bd. 6)
63 S., geb., 1989
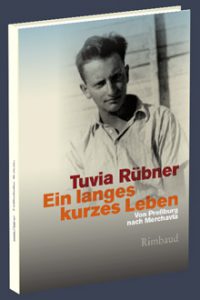
Autor:
Rübner, Tuvia
Von Preßburg nach Merchavia
Biographische Erinnerungen
68 Abb., 266 S., geb., 2014
Erweiterte und illustrierte Ausgabe
"Ich lebe in einem blutigen Land. Denke ich zurück, was schwierig ist - nie ist das, was war, das, was es jetzt gewesen zu sein den Anschein hat -, so dünkt mir, in jüngeren Jahren hätte ich diese Tatsache, ich meine den ersten Satz, einfacher akzeptiert, als ich es heute vermag."
"Das ganze Leben ist ja nichts als Erinnerung. Das Licht eines Sternes, der vielleicht vor tausend Lichtjahren schon zerfallen ist. Selbst was wir Gegenwart nennen, ist Erinnerung, da alles Erlebte im Augenblick, wo es uns zu Bewusstsein kommt, wo wir es wissen, Erinnerung wird. Wirklichkeit ist, was wir nicht wissen." "Gräber besagen mir nichts. Sie sind leer. Die Toten leben unter uns, mit uns, wenn wir uns nicht vor ihnen versperren. Manchmal sehe ich sie in den Schatten in der Luft. Das ist seit einem Jahr ganz deutlich geworden. Sie verweilen nicht. Ich spreche sie nicht an und sie sprechen mich nicht an. Wir wissen schweigend voneinander, was zu wissen ist."
Autor:
Rübner, Tuvia
Von Preßburg nach Merchavia
Biographische Erinnerungen
192 S., geb., 2004
"Ich lebe in einem blutigen Land. Denke ich zurück, was schwierig ist - nie ist das, was war, das, was es jetzt gewesen zu sein den Anschein hat -, so dünkt mir, in jüngeren Jahren hätte ich diese Tatsache, ich meine den ersten Satz, einfacher akzeptiert, als ich es heute vermag."
"Das ganze Leben ist ja nichts als Erinnerung. Das Licht eines Sternes, der vielleicht vor tausend Lichtjahren schon zerfallen ist. Selbst was wir Gegenwart nennen, ist Erinnerung, da alles Erlebte im Augenblick, wo es uns zu Bewusstsein kommt, wo wir es wissen, Erinnerung wird. Wirklichkeit ist, was wir nicht wissen." "Gräber besagen mir nichts. Sie sind leer. Die Toten leben unter uns, mit uns, wenn wir uns nicht vor ihnen versperren. Manchmal sehe ich sie in den Schatten in der Luft. Das ist seit einem Jahr ganz deutlich geworden. Sie verweilen nicht. Ich spreche sie nicht an und sie sprechen mich nicht an. Wir wissen schweigend voneinander, was zu wissen ist."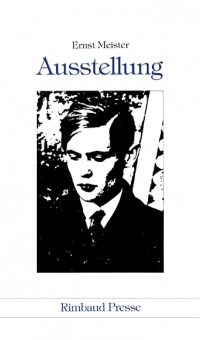
Autor:
Meister, Ernst
Gedichte (1932, Reprint)
(Gedichte in 15 Bänden, Bd. 1)
70 S., fadengeh. Brosch., 1985

Autor:
Meister, Ernst
Gedichte (1953 / 1954)
(Gedichte in 15 Bänden, Bd. 2)
69 S., fadengeh. Brosch., 1986
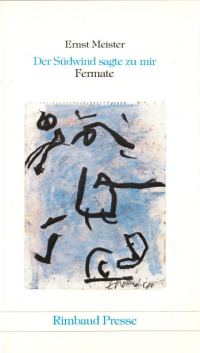
Autor:
Meister, Ernst
Gedichte (1955 / 1957)
(Gedichte in 15 Bänden, Bd. 3)
63 S., fadengeh. Brosch., 1986

Autor:
Meister, Ernst
Gedichte (1956 / 1958 / 1959)
(Gedichte in 15 Bänden, Bd. 4)
95 S., fadengeh. Brosch., 1987
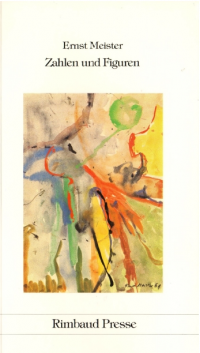
Autor:
Meister, Ernst
Gedichte (1958)
(Gedichte in 15 Bänden, Bd. 5)
127 S., fadengeh. Brosch., 1987
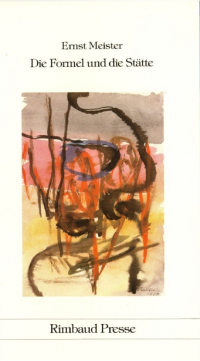
Autor:
Meister, Ernst
Gedichte (1960)
(Gedichte in 15 Bänden, Bd. 6)
95 S., fadengeh. Brosch., 1987

Autor:
Meister, Ernst
Gedichte (1962)
(Gedichte in 15 Bänden, Bd. 7)
127 S., fadengeh. Brosch., 1988

Autor:
Meister, Ernst
Verstreut veröffentlichte Gedichte (1932–1964)
(Gedichte in 15 Bänden, Bd. 8)
80 S., geb., 1997
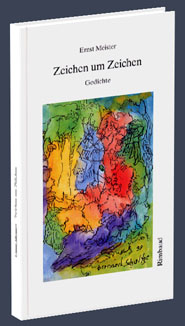
Autor:
Meister, Ernst
Gedichte (1968)
(Gedichte in 15 Bänden, Bd. 9)
160 S., geb., 1999
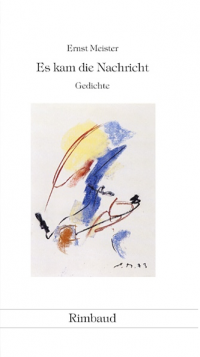
Autor:
Meister, Ernst
Gedichte (1970)
(Gedichte in 15 Bänden, Bd. 10)
95 S., geb., 1990
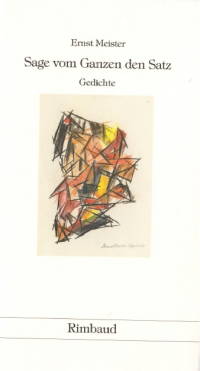
Autor:
Meister, Ernst
Gedichte (1972)
(Gedichte in 15 Bänden, Bd. 11)
128 S., geb., 1996
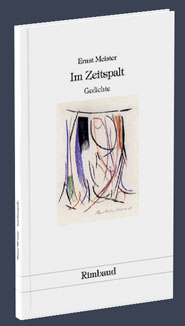
Autor:
Meister, Ernst
Gedichte (1976)
(Gedichte in 15 Bänden, Bd. 12)
64 S., geb., 1994
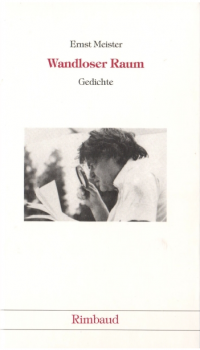
Autor:
Meister, Ernst
Gedichte (1979)
(Gedichte in 15 Bänden, Bd. 13)
96 S., geb., 1996

Autor:
Meister, Ernst
Verstreut veröffentlichte Gedichte (1964–1979)
(Gedichte in 15 Bänden, Bd. 14)
64 S., geb., 1998

Autor:
Meister, Ernst
(Gedichte in 15 Bänden, Bd. 15)
288 S., geb., 1999
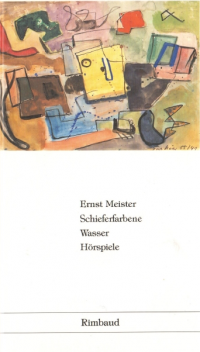
Autor:
Meister, Ernst
Drei Hörspiele
Hörspiele Teil 1
128 S., geb., 1990

Autor:
Meister, Ernst
Drei Hörspiele
Hörspiele Teil 2
128 S., brosch., 1994
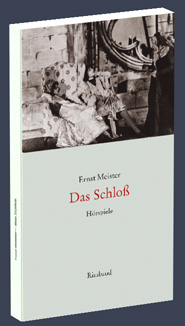
Autor:
Meister, Ernst
Sieben Hörspiele
Nachwort von Jürgen Nelles
Hörspiele Teil 3
168 S., fadengeh. Brosch., 2008

Autor:
Stürmer, Rolf
Erzählung
95 S., geb., 1987
Seit 1987 hat der Autor kein neues Buch veröffentlicht. Ein Gespräch im Frühjahr 2025 ergab, dass sein Leben wie "eine lange Spur von Trümmern, jeden Tag mehr Trümmer, noch mehr Trümmer, lange, lange Spuren von Trümmern, und nichts was sie hinwegräumen kann" (Tennessee Williams) verlaufen ist.

Autor:
Gorostiza, José
Gedicht (1939) (spanisch / deutsch)
(Werke Bd. I, übersetzt von Rudolf Wittkopf und Lothar Klünner,
hrsg., mit Anmerkungen und einem Nachwort von Alberto Perez-Amador)
1 Abb., 104 S., geb., 1995
Die vorliegende Werkausgabe ist die erste deutsche Übersetzung der Lyrik José Gorostizas. «Endloser Tod» schließt einen Zyklus der Poesie ab: er ist das Monument, das die Form ihrem eigenen Tod errichtet hat. Nach «Endloser Tod» ist die Erfahrung des Gedichts – im Sinne von Gorostiza – unmöglich und undenkbar. Andere Erfahrungen, andere Tode, erwarten uns. «Endloser Tod» ist die Uhr aus Bergkristall der hispano-amerikanischen Poesie: für sich allein stehend und von schlankem Wuchs besingt dieses Gedicht die endlose Zeit.
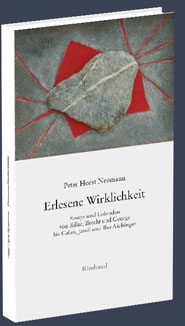
Autor:
Neumann, Peter Horst
Essays und Lobreden von Rilke, Brecht und George bis Celan, Jandl und Ilse Aichinger
(Band II der Gesammelten Essays und Lobreden)
160 S., geb., 2005
Aus dem Inhalt: Vorworte Allmächtige Gleichnis-Schöpfer Zur Krise des Vergleichs in der literarischen Moderne Rilkes Archaischer Torso Apollos in der Geschichte des modernen Fragmentarismus «Von diesen Städten wird bleiben der Wind» Stefan George und Bertolt Brecht Wolfgang Hildesheimer und Stefan George Ernst Jandl «bearbeitet» Rilke Das Nicht-Übersetzbare übersetzen Zur Poetik von Günter Eich «Wir wissen ja nicht, was gilt» Zur Frage der Wertorientierung in neuerer Literatur und zum Problem des Zitierens Über das Singen in Celans Gedichten Übersetzungsprobleme, deutsch-polnisch Zu einem Gedicht von Tadeusz Rózewicz Lobrede auf Rainer Malkowski Vom Unwert des Wissens Lobrede auf Ilse Aichinger Nachworte Anmerkungen Peter Horst Neumann begann seinen Weg in Leipzig als Sänger und Musiker. Diese Prägung ist kenntlich geblieben in seinen Essays und Lobreden auf Gestalten und Werke der deutschen Literatur und Musik; in einem zum Staunen geöffneten Blick auf die «Erschriebenen Welten» der Dichter, in denen wir lesend Heimatrechte erwerben, und in der gelebten Einheit von Poesie, Gelehrsamkeit und Musik.

Leben und Werk in Texten, Bildern, Dokumenten
116 Abb., 96 S., geb., 1991
Werkentwicklung und Lebensgang Ernst Meisters sind weitgehend unbekannt, und das trotz der Tatsache, daß das Werk immer wieder auf seinen Schöpfer verweist, mithin auch biographische Kenntnisse fordert. Eine Meister-Chronik, nichts anderes will dieses Buch sein, trägt diesem Desiderat Rechnung; soweit es eben die Materiallage erlaubt. Sie enthält Selbstaussagen und -deutungen Meisters, die so etwas wie eine fragmentarische Autobiographie darstellen, soweit die Erinnerungen Alice Kochs, seiner Frau, aber auch unveröffentlichte oder schwer zugängliche Dokumente und Fotos, wichtige Rezensionen und Gedichte.
Herausgegeben von Theo Buck
Bearbeitet von Bernhard Albers, Reinhard Kiefer, Marc Houben
224 S., brosch., 1994
Herausgegeben von Theo Buck
Bearbeitet von Bernhard Albers, Reinhard Kiefer
165 S., brosch., 1996
134 S., brosch., 1997
aus der Sammlung Pali Meller Marcovicz
(Bibliothek des Blicks Bd. IV)
deutsch, english, français
42 Duotone-Abb., 64 S., geb., 1996
Beiträge von Dieter Breuer, Klaus Johann, Ursula Gundlach, Markus Bauer, Rolf Bulang, Dieter Bänsch, Friedemann Rosdücher, Martin Linnhoff, Richard Dove, Jürgen Egyptien, Dieter Breuer, Reinhard Kiefer 15 Abb., 130 S., brosch., 1998

4 Abb., 160 S., brosch., 1999
Herausgegeben von Bernhard Albers
148 S., brosch., 2000
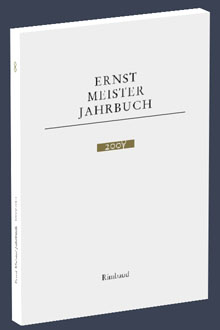
Herausgegeben von Bernhard Albers, Reinhard Kiefer
Beiträge von Hans Bender, Klaus Johann, Hans G. Huch, Frank Nöllenburg, Reinhard Kiefer, Hermann Jansen
140 S., brosch., 2002
Die vorliegende Sammlung bietet einen Querschnitt durch Günter Lansers poetische Arbeit aus den letzten dreißig Jahren. Der Autor hat nicht sehr viel veröffentlicht, zwischen 1964 und 1984 erschienen die zum Teil recht schmalen Bände «An den Ufern» (1964), «Schwarznebel» (1973), der zweisprachige Auswahlband «Viadukte – Viaducs» (1977) und schließlich «Nachtworte» (1984). Alle diese Bände sind vergriffen oder zum Teil schwer zugänglich, so daß eine erneute Präsentation von Lansers Lyrik schon längst überfällig ist.
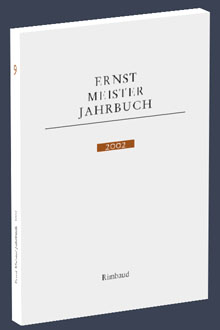
Herausgegeben von Bernhard Albers, Reinhard Kiefer
6 Abb., 112 S., brosch., 2003
Beiträge von Reinhard Kiefer, Hans G. Huch, Walter Israel, Theo Buck, Dieter Breuer
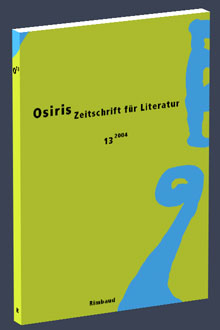
An und für Ernst Meister
116 S., brosch., 2004
Mit Beiträgen von: Ernst Meister, Erich Jansen, Emil Barth, Erich Arendt, Moses Rosenkranz, Alfred Kittner, Rudolf Hartung, Max Hölzer, Karl Schwedhelm, Hans Bender, Michael Guttenbrunner, Alfred Gong, Tuvia Rübner, Elisabeth Axmann, Dagmar Nick, Oskar Pastior, Paul Wühr, Gerhard Neumann, Walter H. Fritz, Joseph Kopf, Karin Dosch, Werner Dürrson, Haralod Hartung, Günter Lanser, Horst Bingel, Peter Härtling, Friedemann Rosdücher, Christoph Meckel, Peter Horst Neumann, Jörg Stöhrer, Michael Krüger, Julia Weiteder-Varga, Andreas Reimann, Ingram Hartinger, Richard Dove, Ralph Dutli, Hans Weßlowski, Reinhard Kiefer, Matthias Kehle, Jürgen Nendza, Christoph Leisten, Andreas Altmann, Olga Martynova, Frank Schablewski, Christoph Wenzel.
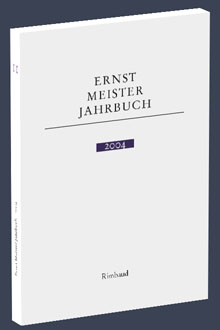
112 S., brosch., 2006
Bei uns vergriffen! Out of print!
Inhalt Friedemann Rosdücher: Erinnerungen an Ernst Meister. Fußnoten zur Biografie Dietmar Keilitz: Hommage à Ernst Meister Zwei Diptychen Berthold Damshäuser / Ramadhan K. H. Penerbit: Sang waktu panjang atau pedek Eine Übersetzung ins Indonesische Maria Behre: Vorstellungen der Ganzheit bei Ernst Meister in Auseinandersetzung mit Karl Löwith und Paul Valéry, ausgehend vom Gedicht «Sage vom Ganzen den Satz» Tengiz Iremadze: ერნსტ მაისტერი – არარაში სახლობენ კითხვები მართლაც … Ernst Meister – Im Nichts hausen die Fragen … Übersetzungen ins Georgische Martin Linnhoff: «Many have no Speech» Das Werk Ernst Meisters in Übersetzungen. Ein Verzeichnis.
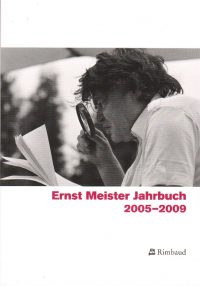
9 Abb., 192 S., fadengeh. Brosch., 2009
Beiträge von Bernhard Albers · Elisabeth Axmann · Ulisse Dogà · Richard Dove · Ria Endres · Walter Helmut Fritz · Klaus Johann · Reinhard Kiefer · Eckhard Kleßmann · Joseph Anton Kruse · Christoph Leisten · Ernst Meister · Jürgen Nelles · Andrea Neuhaus · Walter Neumann · Paul Raabe · Friedemann Rosdücher · Christian Teissl · Christoph Wenzel · Rosemarie Zens
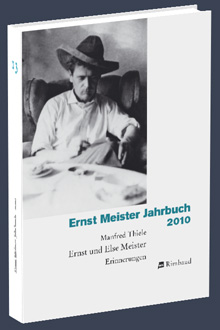
Autor:
Koch, Alice
Manfred Thiele
Ernst und Else Meister
Erinnerungen
28 Abb., 120 S., geb., 2010
Während ihrer Sommerurlaube Mitte der fünfziger Jahre in Horsmar nahe Mühlhausen lernte ich Else und Ernst Meister kennen und sehr bald auch schätzen. Dank meiner literarischen Ambitionen, die ich damals als junger Buchhändler hatte, wurde aus der zufälligen Bekanntschaft schließlich eine enge Freundschaft, die mehr Bedeutsamkeit erlangte, als ich anfangs vermutete. Zweifellos sind viele meiner Erinnerungen im Akt der Anrufung zerronnen. Vielleicht können diese Erinnerungen, die auf Aufzeichnungen meiner Tagebücher beruhen, dem Leser noch einen guten Gesamteindruck jener für mich so wichtigen Begegnung vermitteln.

Autor:
Fabri, Albrecht
Jahrgang 1911
Hrsg. Bernhard Albers
112 S., geb., 2012
Emil Cioran Ernst Meister Albrecht Fabri Inhalt: Teil I Albrecht Fabri: Fragment, Aphorismus, Essay Emil Cioran: Gedankendämmerung Albrecht Fabri: Gedanken über den Gedanken Ernst Meister: Ausgewählte «Gedanken eines Jahres» Teil II Bernhard Albers: Erinnerung an Albrecht Fabri Felix Kampel: Ein Schriftsteller als Philosoph und Aphoristiker. Der junge Emil M. Cioran Richard Dove: Das Chaos als Steuermann. Über Ernst Meisters Aphorismussammlung «Gedanken eines Jahres»
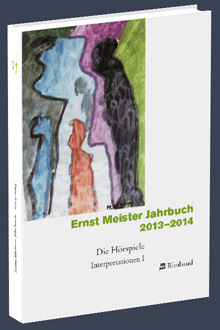
Die Hörspiele
Interpretationen I
142 S., geb., 2014
Die Hörspiele Ernst Meister hat dreizehn Hörspiele verfasst, die zwischen 1963 und 1975 von Radio Bremen und dem Süddeutschen Rundfunk ausgestrahlt worden sind und deren Texte in gedruckter Form vorliegen. Die dem ‹traditionellen Worthörspiel› zuzurechnenden Stücke, die alle eine im weitesten Sinne ‹Geschichte› erzählen, kreisen thematisch – in stärkerem Maße als die Gedichte des Dichters Ernst Meister – um alltägliche Begebenheiten und Begegnungen, um persönliche Erlebnisse und Erfahrungen.

Autor:
Schablewski, Frank
Gedichte
96 S., fadengeh. Brosch., 2003
Die Künstler der Renaissance und später des Barock haben den toten Körper geöffnet, um Wesen und Physiognomie des Menschen zu sezieren in Bild und Gestalt. Nach diesem Muster verfährt Frank Schablewski heute mit der Sprache. Er hat allerdings mit dem Motiv und der Motivation das Reich des Thanatos mit dem des Eros getauscht. Die Gedichte seines neuen Buches Eros Ionen bestehen aus Schlüsselwörtern, mit denen Liebende sich zu erkennen geben. Die Idee zu diesem Buch entstand im vergangenen Jahr während eines Stipendiums im Künstlerdorf Schöppingen bei Münster. Dieses Jahr erhält der 1965 in Hannover geborene Autor den Förderpreis der Landeshauptstadt Düsseldorf.
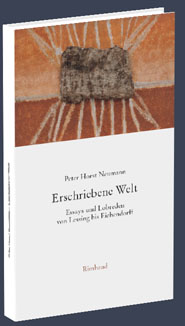
Autor:
Neumann, Peter Horst
Essays und Lobreden von Lessing bis Eichendorff
(Band I der Gesammelten Essays und Lobreden)
144 S., geb., 2004
Aus dem Inhalt: Die Sinngebung des Todes als Gründungsproblem der Ästhetik Lessing und der Beginn der Moderne Die Kunst des Abschiednehmens Eine literaturwissenschaftliche Abschiedsvorlesung über den Derwisch in Lessings «Nathan» und Goethes «Iphigenie» Vorgriffe auf die Unsterblichkeit Das Scheintod-Motiv bei Jean Paul Wahrheit, Trost und Schrecken Jean Pauls Rede des toten Christus Goethes Mittagsschlaf auf dem Papst-Thron und Der «Chinese in Rom» «Judas Wüstenlieder sind unsere deutschen Volksgesänge» Heines Selbstverständnis als Deutscher und Jude Ein schöner Zwischenfall der deutschen Musik Felix Mendelssohn Bartholdy Joseph von Eichendorff: Singen als symbolische Handlung Anmerkungen
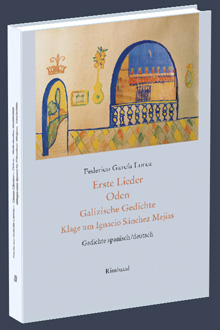
Autor:
García Lorca, Federico
Gedichte spanisch/deutsch
übersetzt und erläutert von Ulrich Daum
148 S., geb., 2010
Federico García Lorca dürfte neben Jorge Luis Borges und Octavio Paz der in Deutschland bekannteste spanischsprachige Lyriker und – neben Cervantes – der bekannteste spanische Dichter sein. Sein Leben endete viel zu früh, im Jahr 1936, zu Beginn des spanischen Bürgerkrieges, als er von faschistischen Schergen ermordet wurde. Seine Schauspiele – vor allem «Bernarda Albas Haus» – haben Millionen von Zuschauern in ihren Bann gezogen. Seine Lyrik erschüttert immer wieder unzählige Leser. Aber noch gibt es lyrische Werke, die nicht, nicht vollständig oder nicht adäquat ins Deutsche übersetzt sind. Einige von diesen werden hier veröffentlicht: Zunächst die «Ersten Lieder» (Primeras canciones) von 1927, die bisher von niemandem vollständig ins Deutsche übersetzt worden sind. Sodann die Oden, die nicht Bestandteil eines größeren Gedichtszyklus sind, nämlich die «Ode auf Salvador Dalí» (1926), die Lorcas musikalischem Lehrmeister Manuel de Falla gewidmete «Ode auf das Allerheiligste Sakrament des Altars» (1926 – 1928) und die in klassischem Stil verfasste Ode «Einsamkeit» (1928). Erstere ist deutschen Lesern nur in einer mangelhaften Übersetzung zugänglich, die zweite ist bisher nur zum Teil übersetzt und die dritte, soweit ersichtlich, noch gar nicht. Ferner die «Galizischen Gedichte» (Poemas galegos) aus den Jahren 1932 – 1935, die bisher ebenfalls noch nicht ins Deutsche übersetzt wurden, wohl deshalb, weil sie in galizischer Sprache verfasst und in spanischer Sprache nicht allgemein zugänglich oder nur zum Teil vorhanden sind. Das eindrucksvollste dieser Gedichte ist der Tanz des Mondes in Santiago, eine unter die Haut gehende Wiedergeburt des uralten Totentanz-Motivs. Schließlich das Klagelied für den mit Lorca befreundeten Stierkämpfer Ignacio Sánchez Mejías (Llanto por Ignacio Sánchez Mejías) von 1934. Es ist in Teilen gut übersetzt vorhanden, aber noch nicht adäquat vollständig übersetzt worden. Es handelt sich um eine Elegie auf den Tod eines hochgeschätzten Menschen, kann aber auch als Elegie über Leben und Tod ganz allgemein verstanden werden und gehört jedenfalls zu den wenigen ganz großen Elegien der Weltliteratur. Die Gedichte wurden von Ulrich Daum ins moderne Deutsch übertragen. Den Gedichtszyklen wird jeweils eine Einführung vorausgeschickt, und wo es sinnvoll ist, werden Erläuterungen angefügt.
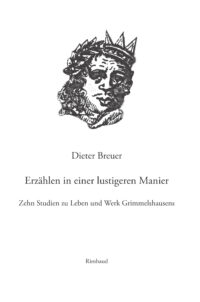
Von Dieter Breuer
Zehn Studien zu Leben und Werk Grimmelshausens
ca. 160 S., fadengehftet, Festeinband, 2023
Seit die romantisch-revolutionären Schriftsteller um 1800 und das damals neugegründete Universitätsfach Germanistik Grimmelshausen wiederentdeckten, von dem sie zunächst nicht einmal dessen wirklichen Namen, nur seine Pseudonyme kannten, haben ernstzunehmende deutschsprachige Schriftsteller, aber auch zahlreiche bildende Künstler dem simplicianischen Autor ihre Reverenz erwiesen. Gerühmt wird vor allem seine immer noch erstaunlich frische, saft- und kraftvolle, unverbrauchte, reiche Sprache. Hans Magnus Enzensberger vergleicht sie mit einer alten Münze, die unabgenutzt immer noch so glänzt, als wäre sie erst heute geprägt. Man könne kaum glauben, so schreibt er, dass sie „aufs Jahr genau so alt ist wie das Schloss von Versailles, so alt wie Racines Berenice und die Allonge-Perücke“. Man bewunderte aber auch Grimmelshausens Kunst der realistischen Darstellung, die Plastizität und Freiheit seiner Figuren, den ungezwungenen Umgang mit Stoffen und Formen der Tradition, seine diskrete, überkonfessionelle Christlichkeit.
Die vorliegenden zehn Studien über die Dichtungen Grimmelshausens sind in jahrzehntelanger Beschäftigung mit diesem faszinierenden Autor entstanden. Sie erscheinen erneut in der Hoffnung, Neugier auf den großen Dichter der Barockzeit zu wecken, der ohne Scheu zugab, dass er nicht zu den Gelehrten gehöre und für Leser aller Stände und Schichten schreibe.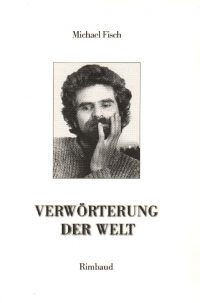
Autor:
Fichte, Hubert
Fichte-Studien Bd. 1
Studien zur Literaturgeschichte Bd. 1
von Michael Fisch
Über die Bedeutung des Reisens für Leben und Werk von Hubert Fichte
Orte – Zeiten – Begriffe
288 S., brosch., 2000
Die vorliegende Arbeit soll neben der Werkinterpretation eines der bedeutendsten deutschen Schriftsteller seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs auch die Analyse eines aufregenden und unsteten Lebens enthalten. Über die Bedeutung des literarischen Grenzgängers Hubert Fichte wird in Fachkreisen kaum mehr gestritten, wenngleich die Bekanntheit seines Werkes noch immer nicht vorausgesetzt werden kann. Die vorliegende Arbeit bietet die Darstellung eines Schriftstellerlebens und die Analyse eines Schriftstellerwerks. Sie ist in den Kontext der bestehenden Literaturwissenschaft eingebettet und im streitbaren Verhältnis zur institutionalisierten Wissenschaft entstanden. Der Leser dieser Arbeit wird einen erzählenden Ton bemerken, der im Kontrast zum allgemeinüblichen Ton einer allgemeinüblichen philologischen Arbeit steht. Der Verfasser dieser Arbeit bemüht sich, seine Position als Literaturwissenschaftler möglichst wenig von der des Lesers zu entfernen.
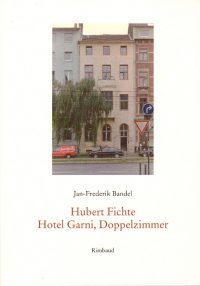
Autor:
Fichte, Hubert
Fichte Studien Bd. 2
von Jan-Frederik Bandel
Über Hubert Fichte
88 S., brosch., 2004
Noch lieferbar. 2. Auflage in Vorbereitung
Inhalt:
Schrobenhausener Recherchen Zum biografischen Fundament von Hubert Fichtes Waisenhaus 1. Namen ; 2. Schrobenhausener Recherche ; 3. Akten ; 4. Die Entstehung eines Gespenstes ; 5. Romankreise Der schreibende Hirte Hubert Fichte in Montjustin, 1959–62 1. Hotel Garni, 1962 ; 2. In Gionos Welt ; 3. Etwas in Serges Gesicht ; 4. Hirte, Künstler, Ödipus und Lagerleiter ; 5. Stationen Anmerkungen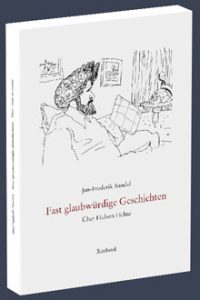
Autor:
Fichte, Hubert
Fichte Studien Bd. 3
von Jan-Frederik Bandel
Über Hubert Fichte
356 S., brosch., 2005
Bei uns vergriffen! Out of print!
Inhalt:
I. Spökenkiekerei und Betriebsamkeit Gespräch mit Herbert Jäger. ; Herbert Jäger: Versuch über die Pubertät. Brief an Hubert Fichte, 1. August 1974. ; Ulrich Krause: Hubert Fichte. Ein neuer Erzähler. ; Gespräch mit Ulrich Krause. ; Gespräch mit Hans Christoph Buch. ; Gespräch mit Hermann Peter Piwitt. ; Günter Guben: Eine fast glaubwürdige Geschichte von Hubert Fichte. II. In Wollis Welt Wolli Köhler: H.F. ; Ein langes Gespräch mit Wolli und Linda Köhler. ; Wolli Köhler: Lebenslauf eines roten Krokodils. ; Jim Wafer: Narrative Therapy. ; Gespräch mit Renate Durand. ; Gespräch mit Peggy Parnass. III. Fichte lesen, Fichte hören Brigitte Kronauer: Dankeswort. Hubert Fichte Preis 1998. ; Gespräch mit Kathrin Röggla. ; Gespräch mit Klaus Sander. Autoren und Gesprächspartner Anmerkungen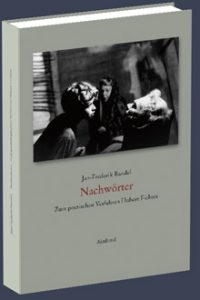
Autor:
Fichte, Hubert
Fichte Studien Bd. 7
von Jan-Frederik Bandel
Zum poetischen Verfahren Hubert Fichtes
304 S., geb., 2008
Inhalt
1. Rückkopplung. Zum Umgang mit der Literatur Hubert Fichtes 1.1 Nachwörter. Vorspiel im Star-Club ; 1.2 Das Leben, ein Roman. Poetologische Szenen I ; 1.3 Transformation. Lektüremodell I ; 1.4 Autobiografik und Roman. Lektüremodell II ; 1.5 Rettende Wörter. Poetologische Szenen II 2. Von Worten und Menschen. Effekt- und Gewaltfragen 2.1 Gespenster. Rückkopplungseffekte I ; 2.2 Existenzexperimente. Poetik der Autofiktion ; 2.3 Raddatz' Gegendarstellung. Rückkopplungseffekte II ; 2.4 Mephisto-Variationen. Exkurs zum Schlüsselroman ; 2.5 Mordwerkzeuge. Referenz und Sprachkritik 3. Kunstfigur, mehrfachbelichtet. Figuren der Anderen 3.1 Menschliche Komödie. Von der Lehranalyse zum Interview ; 3.2 Simulierte Mündlichkeit. Authentizitätseffekte ; 3.3 Wolli, Kunstfigur. Rückkopplungseffekte III ; 3.4 Wolli, mehrfachbelichtet. Verweisnetze I 4. Hybride Formen. Strategien der Ambiguität 4.1 Hybridisierungen. Strategien der Ambiguität I ; 4.2 Hotel Garni, Doppelzimmer. Die Erkenntnisfalle ; 4.3 In der Drehtür. Strategien der Ambiguität II ; 4.4 Flimmerig und unbestimmt. Verweisnetze II ; 4.5 Wie hermetisch ist die Palette? Verweisnetze III ; 4.6 Plädoyer für Jäcki. Postscriptum Verwendete Literatur Anmerkungen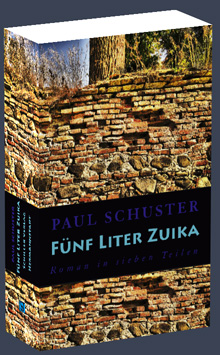
Autor:
Schuster, Paul
Roman in sieben Teilen
864 S., brosch., 2009
Paul Schusters Kleinsommersberg am Fuße der Karpaten ist ein Sachsendorf, das es nicht gibt. Doch in diesem Werk tut sich uns eine kleine Welt auf, die märchenhaft und höchst realistisch alles birgt und alles zeigt, was die Deutschen in Siebenbürgen in 800 Jahren aus ihrem Leben gemacht haben.
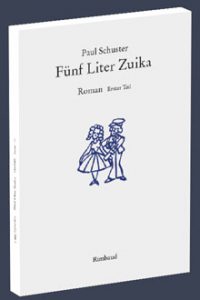
Autor:
Schuster, Paul
Roman
Erster Teil: Die Hochzeit
160 S., brosch., 2002
Wie übersteht ein siebenbürgischer Bauernhof den Frieden von Trianon und den Rutsch aus dem Abendland in den Balkan? Wie Martin Luthers Feste Burg und Hitlers tausendjähriges Reich? Wie die Deportation nach Rußland und wie Stalin, den weisen Lehrmeister aller Völker, wie schließlich 1967 den Händedruck von Ceausescu und Willy Brandt? Und wie die späte Rückkehr in das Land, aus dem die Vorfahren vor 850 Jahren ausgewandert sind? Paul Schuster hat aufgeschrieben, was der Ortsgeist von Kleinsommersberg ihm diktiert hat.
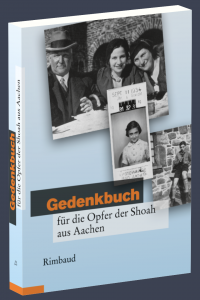
Hg. vom Gedenkbuchprojekt für die Opfer der Shoah aus Aachen e.V.
Mit einem Grußwort des Oberbürgermeisters der Stadt Aachen Marcel Philipp
182 Abb., 360 S., Klappenbrosch., 2019
Liebe Kinder
Bin abgereist. / Seid ohne Sorge, wenn ich nicht schreibe. / Hoffe auf gesundes Wiedersehen. / Grüßt Ernst, Lotte u. Kinder. / Eure Mutter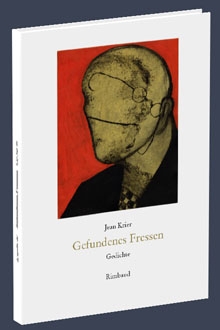
Autor:
Krier, Jean
Gedichte
80 S., geb., 2005
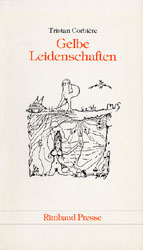
Autor:
Corbière, Tristan
Gedichte (1873)
(französisch / deutsch)
übertragen von Reinhard Kiefer und Ulrich Prill
83 S., fadengeh. Brosch., 1985
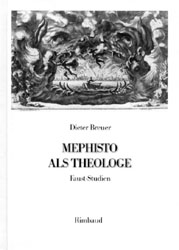
Goethe-Studien I
von Dieter Breuer
Faust-Studien
96 S., geb., 1999
Die folgenden vier Studien, die zwischen 1980 und 1992 an z.T. entlegenen Orten erstmals publiziert wurden, widmen sich ganz den religiösen Fragen des Goetheschen Faust, aufeinander aufbauend, kreisen sie die theologischen Voraussetzungen und die dramaturgischen Konsequenzen von Goethes Umwertung und Neuorganisierung des Faust-Mythos ein. Sie wollen zugleich die historische Bedeutung dieser Umwertung gegenüber der Historia von D. Johann Fausten und Thomas Manns Doktor Faustus kenntlich machen. Beginnend mit einer Untersuchung der christlichen Mythologie in der Szene «Bergschluchten», endend bei der Theologie Mephistos, ergibt sich für den Leser hier der vertraute Gang «vom Himmel durch die Welt zur Hölle».
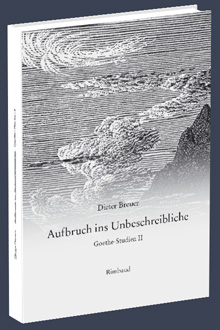
Goethe-Studien II
von Dieter Breuer
128 S., geb., 2010
Wer aufhört, mit den Meistern seiner Kunst zu conversiren, der kommt nicht vorwärts, und ist immer in Gefahr zurückzuschwanken. Von jedem Talent soll man ein unermüdetes Bestreben, eine Selbstverläugnung fordern, von der sich aber niemand einen Begriff machen will. Jeder möchte die Kunst gern auf seine eigene Weise besitzen, sie aber will nur auf die ihrige geworben und erworben seyn. Wie oft seh' ich Talente die sich gebärden wie eine Wespe an der Fensterscheibe; sie möchten das Undurchdringliche mit dem Kopf durchbohren; das ginge, denken sie, weil es durchsichtig ist.
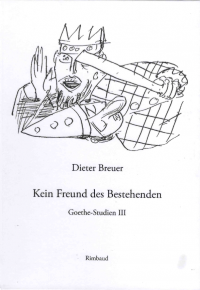
Goethe-Studien III
von Dieter Breuer
96 S., geb., 2022
Enthält 19 Abbildungen
Aus der Vorbemerkung:
Goethes Kritik der Französischen Revolution und revolutionärer Importe bedeutet nach seinen von Eckermann überlieferten Worten aber nicht, dass man ihn den geistigen Restauratoren der alten Ordnung zurechnen dürfe. Er sei kein „Freund des Bestehenden“ im Sinne von „Freund des Veralteten und Schlechten“. Die folgenden Studien zu Hermann und Dorothea, zur Natürlichen Tochter und zum I. und IV. Akt im zweiten Teil des Faust werden zeigen, dass Goethe in der poetischen Auseinandersetzung mit dem großen Thema seiner Zeit tatsächlich kein Freund des Bestehenden bzw., wie 1830 im Brief an Freund Zelter noch eindeutiger formuliert, des „noch“ Bestehenden ist. Insofern hat der provokative Titel, unter dem die vier Studien, ursprünglich Vorträge vor der Aachener Goethe-Gesellschaft, nun erscheinen, seine Berechtigung.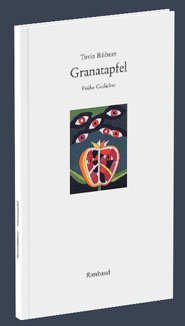
Autor:
Rübner, Tuvia
Frühe Gedichte
Mit einem Nachwort von Hans Otto Horch
64 S., geb., 1995
"Der Titel des schmalen Bandes mit frühen deutschen Gedichten Tuvia Rübners empfiehlt ein Gedicht der Sammlung beseonderer Aufmerksamkeit: Granatapfel. Seit dem Altertum ist der in Hainen angesiedelte krummästig-dornige, scharlachrot blühende Granatapfelstrauch, Punica granatum, im vorderen Orient als Fruchtbaum heimisch; die reife Frucht enthält in einer dünnhäutigen Hülle viele Samenkerne und wurde deshalb früh als Fruchtbarkeitssymbol angesehen - geweiht der phönizischen Astarte ebenso wie Demeter, Hera, Aphrodite oder Athene, verwendet bei Mysterien und vielfach dargestellt. Von der emphatischen Fruchtbarkeitssymbolik findet sich freilich im Gedicht kaum eine Spur - dafür eine emblematische Struktur, wie sie sich im Emblemata-Handbuch Arthur Henkels und ALbrecht Schönes nachschlagen läßt: der Granatapfel erscheint da als Sinnbild der Verbindung guter und schlechter Eigenschaften." - Hans Otto Horch, aus dem Nachwort
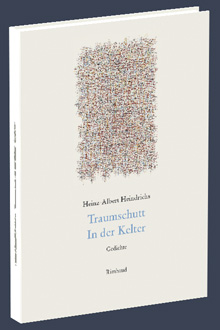
Autor:
Heindrichs, Heinz-Albert
(Gesammelte Gedichte Bd. 1)
116 S., geb., 2010
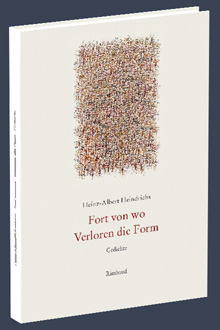
Autor:
Heindrichs, Heinz-Albert
(Gesammelte Gedichte Bd. 2)
116 S., geb., 2010

Autor:
Heindrichs, Heinz-Albert
(Gesammelte Gedichte Bd. 3)
116 S., geb., 2008
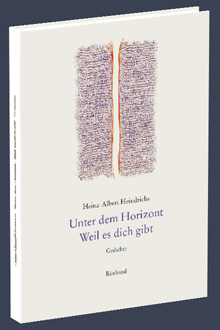
Autor:
Heindrichs, Heinz-Albert
(Gesammelte Gedichte Bd. 4)
116 S., geb., 2008
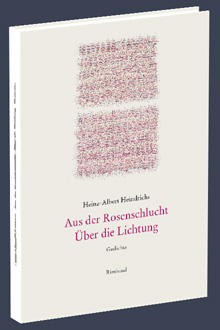
Autor:
Heindrichs, Heinz-Albert
(Gesammelte Gedichte Bd. 5)
116 S., geb., 2009
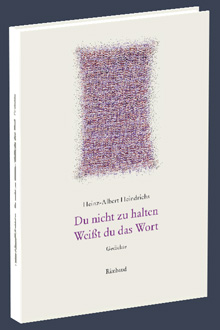
Autor:
Heindrichs, Heinz-Albert
(Gesammelte Gedichte Bd. 6)
116 S., geb., 2009
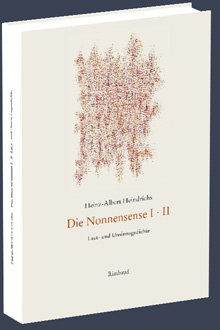
Autor:
Heindrichs, Heinz-Albert
Laut- und Unsinnsgedichte
(Gesammelte Gedichte Bd. 7)
252 S., geb., 2017
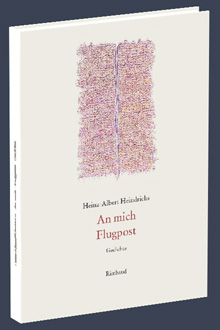
Autor:
Heindrichs, Heinz-Albert
(Gesammelte Gedichte Bd. 8)
116 S., geb., 2009
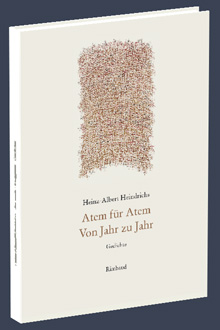
Autor:
Heindrichs, Heinz-Albert
(Gesammelte Gedichte Bd. 9)
116 S., geb., 2009
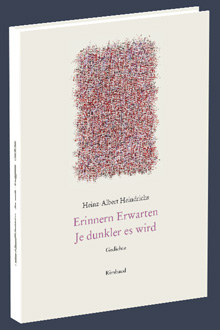
Autor:
Heindrichs, Heinz-Albert
(Gesammelte Gedichte Bd. 10)
116 S., geb., 2009
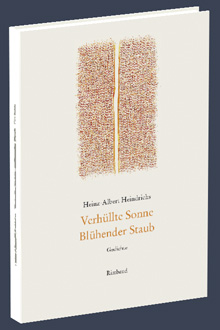
Autor:
Heindrichs, Heinz-Albert
(Gesammelte Gedichte Bd. 11)
116 S., geb., 2010
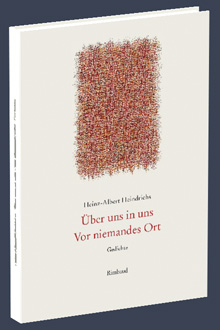
Autor:
Heindrichs, Heinz-Albert
(Gesammelte Gedichte Bd. 12)
116 S., geb., 2010

Autor:
Heindrichs, Heinz-Albert
(Gesammelte Gedichte Bd. 13)
128 S., geb., 2012

Autor:
Heindrichs, Heinz-Albert
(Gesammelte Gedichte Bd. 14)
1 Abb., 160 S., geb., 2012
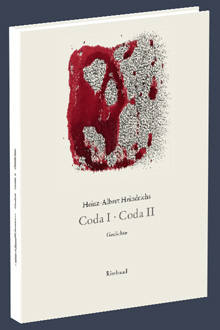
Autor:
Heindrichs, Heinz-Albert
(Gesammelte Gedichte Bd. 15)
118 S., geb., 2013

Autor:
Heindrichs, Heinz-Albert
(Gesammelte Gedichte Bd. 16)
116 S., geb., 2014
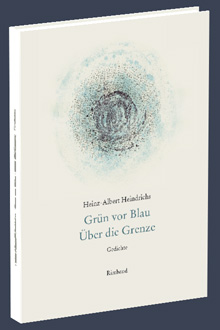
Autor:
Heindrichs, Heinz-Albert
(Gesammelte Gedichte Bd. 17)
116 S., geb., 2015
Der Autor, geboren am 20. Juni 1904 in Berhometh am Pruth, lebte bis 1930 vorwiegend in der Bukowina, dann in Bukarest. 1941 bis 1944 war er in Arbeitslagern der rumänischen Faschisten interniert; 1947, verschleppt nach Rußland, verschwand er für 10 Jahre im Gulag. 1961, wieder politisch verfolgt, mußte er aus Rumänien fliehen und kam nach Deutschland. Er starb am 17. Mai 2003 im Schwarzwald. Die Kindheit erlebte er bis zum 1. Weltkrieg in den Dörfern zwischen Pruth und Czeremosch in einer kinderreichen Bauernfamilie. Dann folgten Flucht, der Tod des Vaters, völlige Verarmung; danach Wanderjahre auf Arbeitssuche. Weiteres zum Lebenslauf im Essay von Matthias Huff. Die ersten fünfzehn Jahre dieses Lebens, das noch viele Katastrophen unseres Jahrhunderts durchlaufen sollte, schildert der Dichter im vorliegenden Hörbuch. Sprecher: Nikolaus Paryla mit einem 40-seitigen Booklet
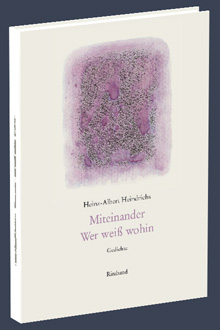
Autor:
Heindrichs, Heinz-Albert
(Gesammelte Gedichte Bd. 18)
116 S., geb., 2017
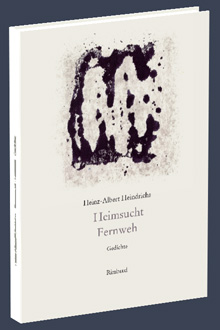
Autor:
Heindrichs, Heinz-Albert
(Gesammelte Gedichte Bd. 19)
130 S., geb., 2018
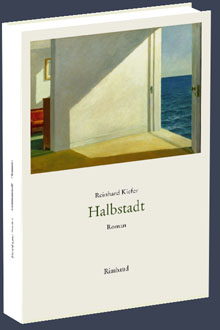
Autor:
Kiefer, Reinhard
Roman
372 S., geb., 2. Aufl. 2013
In sechzehn Kapiteln wird der Weg von drei jungen Menschen Toni Klingson, Alexander Müller und Veronika Vogler beschrieben. Klingson versucht sich als Schriftsteller, Müller als Maler und die Vogler als Muse. Das alles spielt in den 80er Jahren. Dabei werden immer wieder, wenn auch verfremdet, Elemente der Zeitgeschichte eingefügt (die Friedensdemonstration im Bonner Hofgarten, Tschernobyl, der Fall Barschel, der Fall der Mauer). Anfang und Schluß des Romans finden am Silvestermorgen und -nachmittag des Jahres 1989 statt. Das erste und das letzte Kapitel bilden den Rahmen, in dem die Geschichte von Klingson und Müller erzählt wird.
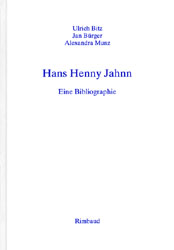
Autor:
Jahnn, Hans Henny
Ulrich Bitz
Jan Bürger
Alexandra Munz
304 S., geb., 1996
Die vorliegende Bibliographie beseitigt den seit Jahren wiederholt kritisierten Umstand, daß einerseits das von Jochen Meyer 1967 vorgelegte «Verzeichnis der Schriften von und über Hans Henny Jahnn» (ergänzt in der 3. Auflage des Heftes Nr. 2/3 von TEXT+KRITIK), das über lange Jahre als zuverlässiger Begleiter jeder Lektüre der Werke diente, keine angemessene Fortführung erfahren hat, und andererseits die mit dem Erscheinen der «Hamburger Ausgabe» zunehmende Beachtung von Jahnn in der literarischen Öffentlichkeit und der Forschung sich nirgendwo verzeichnet findet. Darüber hinaus konnte, was Jochen Meyer noch nicht möglich war, der an der Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky in Hamburg archivierte Nachlaß in einem für die Bibliographie angemessenen Maße ausgewertet werden. Ganz zu schweigen von den seit 1967 bekannt gewordenen Überlieferungssträngen, die sich in den Nachlässen von Jahnn nahestehenden Personen in in- und ausländischen Bibliotheken finden.
www.hans-henny-jahnn.de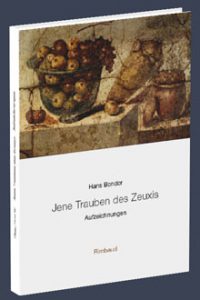
Autor:
Bender, Hans
Aufzeichnungen
(Ausgewählte Werke Bd. 1)
(Über Malerei Bd. 5)
1 Abb., 88 S., geb., 2002
Benders Aufzeichnungen kokettieren weder mit einer geheimnisvoll-pseudophilosophischen Bedeutung noch mit der abgeklärten Gebärde des Weisen, der Altersweisheit. Aber mit seiner unbestechlichen Beobachtung und mit seiner von Phantasie beflügelten Entdeckerfreude erschließt Bender seinen Lesern Welterkenntnis.
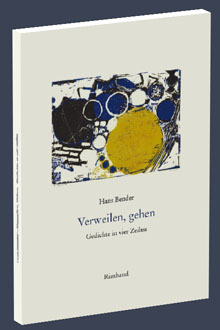
Autor:
Bender, Hans
Gedichte in vier Zeilen
(Ausgewählte Werke Bd. 2)
96 S., fadengeh. Klappenbrosch., 2003
Vierzeiler aber wollen nicht repräsentieren, nicht ihren Autor, nicht einmal sich selbst. Es sind keine anerkannten lyrischen Kunstformen, keine Haikus, keine Tankas. Sind es überhaupt Gedichte? Oder sind es Aufzeichnungen, wie sie Bender sonst auch geschrieben hat? Deren Ideal hat Bender in dem Satz gefaßt: «Einige Sätze, die etwas komprimieren und konzentrieren.» Hier in den Vierzeilern wird nicht einmal das mehr versucht: die Substanz, die zu komprimieren und zu konzentrieren wäre, ist Hauch geworden, Duft: etwas, das immer noch Sprache anlockt, Sprache, die zum Menschen gehört. «Nun kommt / ihr summenden Wörter!»
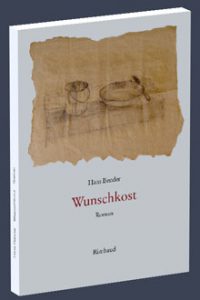
Autor:
Bender, Hans
Roman
(Ausgewählte Werke Bd. 3)
120 S., fadengeh. Klappenbrosch., 2004
Aus Rezensionen nach Erscheinen der «Wunschkost» 1959: Sein Roman «Wunschkost» ist einer der besten deutschen Romane der jüngeren Generation. Bender schildert auf knappe und ergreifende Art die Schrecken der Gefangenschaft und die Herzlichkeit der Freundschaft; es ist die Geschichte von einem unter großen Opfern wunderbar geretteten Leben, das gefühllos wiederum geopfert wird. Es ist ein dichterisches Buch eines bedeutenden Erzählers.
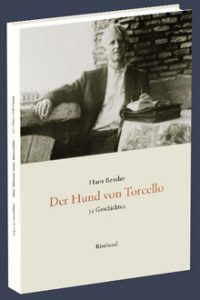
Autor:
Bender, Hans
32 Geschichten
(Ausgewählte Werke Bd. 4)
264 S., geb., 2007
Lieber Hans Bender, ich habe Ihre Erzählung «Die Wölfe kommen zurück», die mich, als ich sie zum ersten mal las, in einer der ersten Akzente-Nummern, so beeindruckt hat, jetzt noch einmal wiedergelesen. Ich fand den Text in dem alten Hanser-Erzählungsband und nun habe ich auch das ganze Buch gelesen, konnte nicht aufhören und trage es noch immer mit mir herum. Es drängt mich Ihnen zu sagen – mit unziemlicher Emphase – bis zur letzten Zeile finde ich Ihre Erzählung und auch das, was sie darüber und über sich selbst schreiben, ganz großartig! Und ich möchte es jetzt allen Menschen sagen, die mir begegnen: lest diese Erzählungen! Sie sind heute, wo unser kollektives Gedächtnis sich mehr und mehr auf das Klischierte, auf das politisch Gewünschte und Korrekte reduziert, die wahren Erzählungen vom Leben in jener Zeit … Ich wünsche mir, Sie hätten so viele Erzählungen wie Tschechow geschrieben.
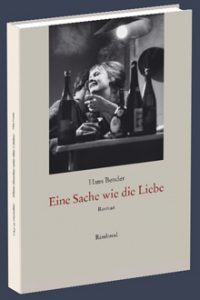
Autor:
Bender, Hans
Roman
(Ausgewählte Werke Bd. 5)
156 S., geb., 2008
Beim Wiederlesen längst vergessen geglaubter Bücher scheint häufig ein Blitz der Erkenntnis auf, der zwar geleuchtet, doch nie so richtig gezündet hatte. Mir ist es jetzt bei der Lektüre von Hans Benders erstem Roman «Eine Sache wie die Liebe» so ergangen: Was mir beim ersten Lesen in den fünfziger Jahren nur als zarte Liebesgeschichte erschienen war, gewann nun eine neue Dimension hinzu.
Es geht mir also bei der Betrachtung dieses Romans nicht nur um die lapidare Erzählkunst Hans Benders, sondern um die Hellsichtigkeit des Autors, die Liebe – von der er erzählt – in der sich neu konstituierenden Gesellschaft der Nachkriegszeit als das zu benennen, zu dem sie geworden ist. Ich spreche auch nicht vom Inhalt des Romans, vom Studenten Robert, der das scheue Flüchtlingsmädchen liebt, zum Studieren in die Ferne reist, andere Arten und Weisen der Liebe kennenlernt und dabei seine Jugendliebe wieder verliert, sondern von Benders Fähigkeit, dieses Phänomen in seiner zeittypischen Verflechtung erzählend zu vergegenwärtigen.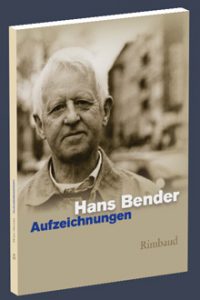
Autor:
Bender, Hans
2000–2007
(Ausgewählte Werke Bd. 6)
120 S., fadengeh. Klappenbrosch., 2014
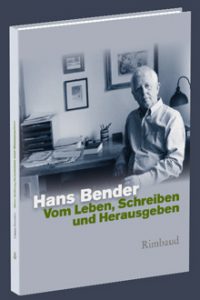
Autor:
Bender, Hans
Hrsg. von Hans Georg Schwark und Walter Hörner
(Ausgewählte Werke Bd. 7)
3 Abb., 112 S., geb., 2018
Hans Bender ist kein Anakreontiker und hat keine Kampf- und Siegeslieder verfasst. Seine Lyrik, seine Geschichten, seine Aufzeichnungen spiegeln die Schicksale seiner Generation: derer, die knapp nach dem Ende des Ersten Weltkriegs geboren wurden und die dem Zweiten noch gerade entkamen. Er hat ihr als Schreibender zu Stimme und Selbstbewusstsein verholfen.
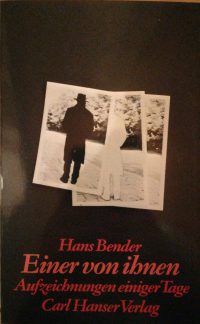
Autor:
Bender, Hans
Aufzeichnungen einiger Tage
(Ausgewählte Werke Bd. 8)
102 S., Erstauflage: 1979 im Hanser Verlag
Übernahme vom Hanser Verlag
Als im Jahr 1987 Bruderherz vorlag, war das sozusagen der späte Abschied von der Kurzgeschichte oder Geschichte, wie Hans Bender lieber sagte. Er hatte sich längst, seit 1970, einer anderen literarischen Form zugewandt: der Aufzeichnung. In einem Interview definierte er sie: „Eine Aufzeichnung soll die Konzentration eines Gedichtes erzielen, ohne dessen Stilgebärde, dessen Angestrengtheit oder gar dessen Schmuck. Die eigene Stimme soll aus der Aufzeichnung sprechen, die Erfahrung, der Gedanke, die Einsicht.“ 1971 waren im Literarischen Colloquium Aufzeichnungen einiger Tage erschienen, ein schmales Heft, das 1979 in Einer von ihnen aufgenommen wurde, der ersten Sammlung mit den Aufzeichnungen der Jahre 1970 bis 1979. Obwohl er gerne Tagebücher las – Julien Green, Jules Renard, Albert Camus gehörten zu seinen Favoriten – hatte er sich gegen tägliche Notizen entschieden. Es gab nur eine Ausnahme, die er in einer Nachbemerkung am Ende des Buches erklärt: „Die Seiten unter dem Titel ‚Einunddreißig Tage‘ erschienen in einem Sammelband Kölner Autoren (Notizbuch. Neun Autoren Wohnsitz Köln, 1972). Einen Monat lang sollte Tagebuch geführt werden.“ Und dann steht da noch in dieser Nachbemerkung: „Der Leser folgt den Aufzeichnungen von der Gegenwart zurückgehend in die Vergangenheit.“ [Weiterlesen]
Hans Georg Schwark

Autor:
Bender, Hans
Erzählungen
(Ausgewählte Werke Bd. 9)
141 S., Erstauflage: 1987 im Hanser Verlag
Übernahme vom Hanser Verlag
Gab es im Leben Herthas, überlegte ich, früher so etwas wie ein Liebeserlebnis? Nur eines fiel mir ein, das traurig ausging. In unserem Dorf hatte sie einen jungen Mann kennengelernt; einen Mechaniker, der in einer Autowerkstatt arbeitete. Wilhelm hieß er. Ein netter, aufgeweckter Junge mit rehbraunen Augen. Er gefiel ihr, und Wilhelm bewunderte Hertha, das Mädchen aus der Stadt. Als sie wieder daheim war, kam er auf seinem Motorrad angebraust und stand erwartungsvoll, in einer Lederjacke mit Reißverschlüssen, vor der Tür. So sehr Hertha sich freute, so verwirrt war ihre Mutter. Sie trug Kaffee und Linzer Torte auf. Hinterher nahm sie Wilhelm mit in die Küche und erklärte ihm in wahrscheinlich schwer verständlichen Umschreibungen, es hätte keinen Zweck, mit ihrer Tochter ein Verhältnis anzufangen. Der verstörte Wilhelm ließ nie mehr von sich hören.
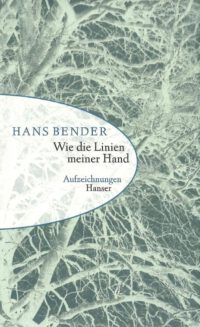
Autor:
Bender, Hans
Aufzeichnungen 1988-1998
(Ausgewählte Werke Bd. 10)
128 S., Erstauflage: 1999 im Hanser Verlag
Übernahme vom Hanser Verlag
"Könnte man doch hinter die Jahre schauen und wissen, was kommt!"
Jene Stimmung erwacht wieder, wenn ich mich heute der Stunde erinnere, als ich den Satz und den Wunsch hinschrieb im Manuskript meines ersten Romans ... Fünfundvierzig Jahre später schaue ich nun auf die Zukunft, die ich voraus zu sehen wünschte, zurück. Sie hat sich vollzogen. Ich überblicke ihren Verlauf und wage zu sagen: Ich habe ihn bestimmt durch mein Wesen, das mir mitgegeben war wie die Linien meiner Hand.Hans Bender

von Albrecht Betz
Ästhetik und Politik I
192 S., geb., 2. erweiterte Aufl. 1999
Als innovativster deutscher Prosaautor des 19. Jahrhunderts hat Heine den Wahrnehmungswandel und die Bewußtseinsveränderung beim Übergang in die industrielle Welt zugleich antizipiert und geprägt. Das legt nahe, jene Nervpunkte genauer zu beobachten, an denen Ästhetisches und Politisches so zusammentreffen, daß Hochspannung entsteht. Die spirituelle Eleganz dieser Prosa erinnert musikalisch an die Technik des Scherzos: auch hier die prägnante Linienführung, Witz als schneller, konzentrierter Fluß der Gedanken mit überraschenden Abweichungen, das Ganze schlank instrumentiert, wo nicht solistisch angelegt auf virtuosen Vortrag. Publikationsverzeichnis
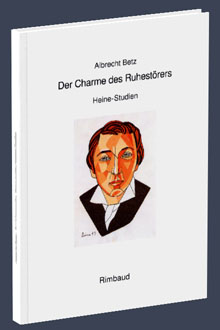
von Albrecht Betz
Ästhetik und Politik II
96 S., geb., 1997
Heinrich Heine – der europäische Deutsche und Kosmopolit in Paris steht im Mittelpunkt von sechs Studien. Was sie sichtbar machen, ist: Heines Aktualität. Aus dem Inhalt: Deutscher – Europäer – Kosmopolit Heine und Benjamin in Paris Vom doppelten Exil zweier deutscher Intellektueller Mit der Fackel die Blöße beleuchten Heine und Heinrich Mann in den Spuren Voltaires Ende oder Anfang? Heines Blick auf die französischen Maler nach der Julirevolution «Der Apollogott» Heine und die Musik Emanzipation der Dissonanz Das letzte Gedicht «An die Mouche»
Publikationsverzeichnis "Betz' Essays haben etwas, 'was von Heine selbst souverän beherrscht wurde: die Kapazität zur synthetisierenden Pointe und zur originellen sowie umsichtigen Persepektivierung.'" - Karl Heinz Bohrer in Merkur 1/98 "Betz arbeitet 'sechs brilliante Studien heraus, deren vekürzter, manchmal schon fast telegraphischer Vortrag zum Nachdenken und zum Widerspruch reizt.'" - Günter Metken in Süddt. Zeitung 7.3.98Autor:
Good, Paul
4 Abb., 96 S., geb., 1993
Drei Variationen eines Heraklit’schen Themas: wie eines in sich unterschieden das andere ist. Bei der informellen Malerei von Gerhard Hoehme begründet dieses Zugleich einen erweiterten Bildbegriff, beim Lyriker Ernst Meister gibt sich eine Gegenwendigkeit der Sprachform vor allem beim Raumbegriff Ausdruck, beim Philosophen Friedrich Nietzsche zersetzt diese Heraklit’sche Intuition den abendländischen Seinsbegriff.
Autor:
Kiefer, Reinhard
Gedichte
Mit 6 Zeichnungen von Wolfgang Wittkämper
28 S., geheftet, 1981
Bestellung nur über den Verlag
Autor:
Fichte, Hubert , Genet, Jean ,
(französisch / deutsch)
Mit Photos von Leonore Mau
64 S., fadengeh. brosch., 1992
Sein umfänglichstes Interview führte Genet 1975 mit Hubert Fichte. Das Buch enthält die französische und die von Fichte übersetzte deutsche Fassung sowie nur hier veröffentlichte Fotos von Leonore Mau.
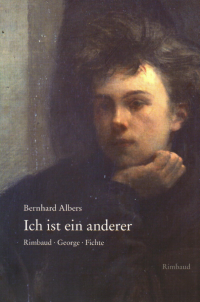
Autor:
Albers, Bernhard
Rimbaud · George · Fichte
20 Abb., 64 S., Klappenbrosch., 2012
Inhalt:
Prolog: Ein Komponist und sein Mäzen - Wagner und Ludwig II. 1. Kapitel: Eine Zeit in der Hölle - Rimbaud und Verlaine Exkurs 1: Das klassische Leben - Wilhelm von Gloeden 2. Kapitel: Die Zwillingsbrüder - George und Hofmannsthal Exkurs 2: Die Wonnen der Gewöhnlichkeit - Thomas Mann Exkurs 3: Das Doppelgrab I - Hans Henny Jahnn Exkurs 4: Das Doppelgrab II - Julien Green Exkurs 5: Wir können nicht lieben - Rolf. Angestellter 3. Kapitel: Eine glückliche Liebe - Fichte und Mau Epilog: Ein Komponist und seine Stimme - Britten und Pears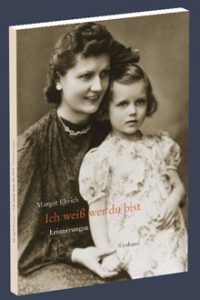
Autor:
Ehrich, Margot
Erinnerungen
88 S., brosch., 2010
Das Paradies, das sind die Orte der Kindheit, die väterliche Wohnung im böhmischen Leitmeritz und das Haus der Urgroßmutter in Hoyerswerda. Dabei waren die Tage der Kindheit keinesfalls unbeschwert, sondern standen im Zeichen von Mangel, Krieg und Tod. Ein lebenskluger Pragmatismus und die kindliche Perspektive sorgen dann aber doch für eine hinreichende Poetisierung: «Im Krieg stinkt es selten nach Gänsebraten.» Kriegs- und Nachkriegswirren, die Flucht aus dem nun tschechischen Gebiet und später aus der DDR führen zum Verlust der Kindheitsorte, die auch nach dem Fall des Eisernen Vorhangs nur durch einen Akt der Erinnerung zu beschwören sind.
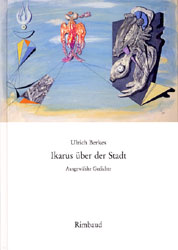
Autor:
Berkes, Ulrich
Ausgewählte Gedichte
96 S., geb., 1997
Berkes wurde durch sein in der DDR erschienenes Lautréamont- Tagebuch «Eine schlimme Liebe» bekannt. Dieser Band gibt eine repräsentative Auswahl aus seinen veröffentlichten sowie auch unveröffentlichten Gedichten.

Autor:
Krier, Jean
Gedichte
Ausgewählt von Frank Schablewski
40 S., fadengeh. Klappenbrosch., 2019
Jean Krier, geboren 1949 in Luxemburg, studierte Germanistik und Anglistik in Freiburg im Breisgau. Er veröffentlichte zahlreich in Literaturzeitschriften (u. a. Akzente, manuskripte, Sprache im technischen Zeitalter), sowie in Rundfunksendungen. Krier starb 2013 in Freiburg im Breisgau.
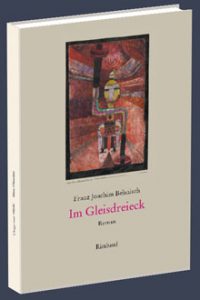
Autor:
Behnisch, Franz Joachim
Roman
180 S., geb., 2006
Franz Joachim Behnisch (1920–1983), geboren und aufgewachsen in Berlin. Krieg, russische Gefangenschaft bis Ende 1948, Studium in München, Promotion in Würzburg. Er lebte, lehrte als Germanist und Historiker, und schrieb in seiner (ihm vom Schicksal zugedachten) Wahlheimat Weiden in der Oberpfalz.
Themen seiner Romane, Erzählungen, Hörbilder, Kurzprosa und Lyrik sind vor allem Berlin und die Zeitgeschichte. Das Buch erschien unter dem vom ursprünglichen Verlag auferlegten Titel «Rummelmusik. Ein Berliner Roman» 1966. Es zeigt den Lebensweg eines «kleinen Mannes», der gegen seinen Willen immer ins Zentrum turbulenter Ereignisse gerät.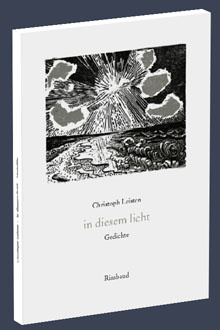
Autor:
Leisten, Christoph
Gedichte
64 S., fadengeh. Klappenbrosch., 2003
Das zweite Buch von Christoph Leisten versammelt luzide Gebilde, die einen Bogen spannen zwischen mitteleuropäischer, mediterraner und maghrebinischer Gegenwartserfahrung.

Autor:
Kiefer, Reinhard
Ein Satzbau IV
128 S., gebunden, 2023
Wie die anderen drei Teile ist auch dieser «Satzbau» geprägt vom Prinzip der Collage: Absicht und Zufall treffen aufeinander.
"Das Wort Indianer ist mittlerweile unerwünscht, wenn nicht verboten. Welche hohe Kommission oder Behörde dieses Verbot ausgesprochen hat, ist nicht herauszubekommen. Wie dem auch sei, dieses toxische Wort muß hier verwandt werden, denn es gehört zu einer Geschichte, die sich in einem Jahrhundert ereignete, das weniger empfindsam war als das gegenwärtige."-Autor Àxel Sanjosé über den Band "Indianer. Ein Satzbau IV"

Autor:
Anders, Richard
Aufzeichnungen 1951–1955
Mit einer Vorbemerkung von Signe Trede-Jahnn
Fotos von Leonore Mau
(Jahnn-Studien Bd. 1)
6 Abb., 93 S., geb., 1988
«Auch heute noch erlebe ich beim Durchlesen die Stimmungen und Gefühle der damaligen Zeit, mit allen Peinlichkeiten – Freuden, Stolz und Scham. Ich höre fast die Stimme meines Vaters. Es ist so, als ob ich diese Zeit oder Abschnitte daraus, wieder erlebe.»

Autor:
Mayer, Hans
(Jahnn-Studien Bd. 2)
88 S., geb., 2. Aufl. 1994
Am Bahnhof Friedrichstraße in Berlin sah ich ihn zum letztenmal. Ein Wochenende im November 1959. Jahnn kaufte sich eine Fahrkarte nach Hamburg, seine letzte. War schon erkältet, klagte, wollte nach Hause. Sprach von dem bevorstehenden 65. Geburtstag am 17. Dezember, auf den er sich freute. Er hat ihn aber nicht mehr erlebt. Am 29. November 1959 starb er einen ärmlichen Krankenhaustod der Unbemittelten … Jahnn mißtraute den Verheißungen des Christentums ebenso wie einer säkularisierten bürgerlichen Kunstreligiosität. Der Gedanke an den Staub machte ihn schaudern. Auf Erhaltung des Gebildes Leib auch nach dem Sterben war er aus: die Balsame der Ägypter, erfunden zur Erhaltung der Materie Einzelmensch, hat er immer wieder beschrieben und gepriesen. War das nicht zu erlangen, so kam alles darauf an, die verwesende Materie vor Neugier zu schützen. Jahnns Bauwerke sind gewaltige Nekropolen, die sich dem Tod entgegenstemmen.

Autor:
Muschg, Walter
Herausgegeben von Jürgen Egyptien
Vorwort von Richard Anders
(Jahnn-Studien Bd. 3)
192 S., geb., 1994
Im Herbst 1933 führte der schweizer Literaturwissenschaftler Walter Muschg (1898–1965) mit dem deutschen Schriftsteller Hans Henny Jahnn in Zürich eine Reihe von Gesprächen, die in vielfältiger Weise mit Jahnns literarischem Werk verknüpft sind. Sie erhellen sowohl den autobiographischen Anteil seines Schaffens als auch die intensive Beschäftigung mit Architektur, Musik, Sexualität und anderen zentralen Themen seines Werks. Muschg hat die protokollierten Aussagen Jahnns zu einem großen Monolog über seine Kindheit und Jugend in Hamburg, seine Jahre in Norwegen während des 1. Weltkriegs, seine Zeit als geistiger Mittelpunkt der Glaubensgemeinde Ugrino, seine literarischen Provokationen und kulturellen Kämpfe in der Weimarer Republik arrangiert.
So können die nach über 25 Jahren hier wieder veröffentlichten Gespräche einen umfassenden Einblick in die persönliche Entwicklung und das ästhetische Denken von Hans Henny Jahnn geben.
Autor:
Albers, Bernhard , Guttenbrunner, Michael ,
Herausgegeben von Bernhard Albers
96 S., fadengeh. Klappenbrosch., 3. überarb. Aufl. 2019
Hans Bender · Horst Krüger
Michael Guttenbrunner Eine Köpenickiade im Hause Zuckmayer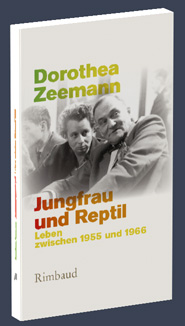
Autor:
Zeemann, Dorothea
Leben zwischen 1955 und 1966
Vorwort Bernhard Albers
1 Abb., 104 S., fadengeh. Brosch., 2013
Am 20. Juni 1955 lernt Dorothea Zeemann den 58-jährigen Autor Heimito Doderer anläßlich einer Lesung von Robert Neumann in Wien kennen. Der Altersunterschied beträgt nur dreizehn Jahre und er macht ihr später Vorwürfe, sie nicht früher kennengelernt zu haben. Erst drei Jahre zuvor hatte er Maria Thoma geheiratet, die weitab von Wien in Landshut wohnt.
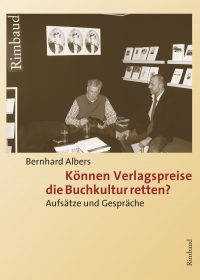
Autor:
Albers, Bernhard
Aufsätze und Gespräche
40 S., geheftet mit Klappen, 2019
"Es waltet in jeder Zeit ein geheimes Bündnis verwandter Geister"
-Robert Schumann

Autor:
Meister, Ernst
Gedicht aus dem Nachlaß
Supplementband 3
Hrsg. und Nachwort von Dieter Breuer
52 S., brosch., 2014
Das «lange Gedicht», von dem Ernst Meister erstmals im Brief an Reinhard Paul Becker (14.2.1956) spricht, gehört nicht zum Konvolut der nachgelassenen Gedichte, den er mit Ilse Demtröder zusammengestellt hat. Entstanden im Umkreis von «Der Südwind sagte zu mir» (1955) und des Dramas «Ein Haus für meine Kinder», unterscheidet es sich durch Umfang und parodistisch-ironische Machart so extrem von Meisters weiterer Entwicklung als Lyriker, daß er es auch nach einer straffenden Bearbeitung 1963/64 wieder und endgültig beiseite legte.

Autor:
Schwedhelm, Karl
Sämtliche Gedichte
(Werke Band 1)
111 S., geb., 1991
Karl Schwedhelm veröffentlichte 1955 seinen einzigen Gedichtband «Fährte der Fische».

Autor:
Schwedhelm, Karl
Essays
(Werke Band 2)
215 S., geb., 1991
Aus dem Inhalt: Zur Poetologie Anatomie der Illusion Die Entstehung eines Gedichts Zu Personen Das metaphysische Abenteuer der Poesie Paul Celan «Mohn und Gedächtnis» Allein: du mit den Worten … «Von nichts, als vom Gedicht beschützt …» Wälder der Traumgesichte Gemisch von Glut und Eis Den Schlaf der Welt stören Eine Notiz Glut und Schlacken Der Weg des Dichters Gottfried Benn Zur zeitgenössischen Literatur Der Mensch als Randfigur Das Gedicht in einer veränderten Wirklichkeit Epik auf Millimeterpapier Nachkriegsliteratur im deutschen Südwesten Anhang Zur Anordnung und Textgestalt

Autor:
Schwedhelm, Karl
Essays aus dem Nachlaß
(Werke Band 3)
184 S., geb., 1993
Aus dem Inhalt: Personen Ernst Bertram zum 70. Geburtstag «Wahr spricht, wer Schatten spricht» Ein Brennpunkt der Mißverständnisse «Unter dem Dach der Sprache» Ein Versuch zur Überwindung des Nihilismus «Zarte Empirie» Auschwitz und Kanaan Zur Kulturgeschichte und Bildenden Kunst Der Aufstand gegen das Bild Figur und Zeichen Gespräch mit Willi Baumeister Raoul Dufy Figur und Zeichen des Seins Nachwort «Wald des Jetzt» Anhang Zur Anordnung und Textgestalt Register
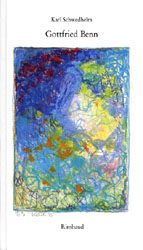
Autor:
Schwedhelm, Karl
Essay und Dokumentation
(Werke Band 4)
7 Abb., 200 S., geb., 1995
In das Jahr 1948 fällt der erste Brief Karl Schwedhelms an Gottfried Benn, in dem dieser um eine «halbstündige Lesung […] für Radio Stuttgart» bittet. Aus der zunächst lockeren Zusammenarbeit mit dem Süddeutschen Rundfunk ergeben sich mit der Zeit für Benn auch wichtige Impulse zu neuen Arbeiten. Karl Schwedhelm erweist sich währenddessen als ein aufmerksamer Beobachter des Bennschen Schaffens und rezensiert einen Großteil seiner Neuerscheinungen. Bis zu seinem Lebensende wird sich Schwedhelm aber immer wieder mit dem herausragenden Lyriker und Essayisten beschäftigen; der etwa 1980/81 entstandene und hier erstmals abgedruckte Essay über die Lebens- und Wirkungsgeschichte des Dichters – «Kunst als letzte Wirklichkeit» – legt davon ein deutliches Zeugnis ab. Ihm folgt eine Dokumentation des vorhandenen Briefwechsels und der Rezensionen Schwedhelms. Den Abschluß bildet eine Fotosammlung.

Autor:
Desbordes-Valmore, Marceline , Schwedhelm, Karl ,
Ausgewählte Gedichte (französisch / deutsch)
Vorw. u. übersetzt von Karl Schwedhelm
(Werke Band 5)
110 S., geb., 1997
Die Übertragung von Karl Schwedhelm stammt aus dem Jahre 1947. Sie ist Bestandteil einer auf acht Bände angelegten Werkausgabe, wovon sechs bereits erschienen sind. Zu den Gedichten von Marceline Desbordes-Valmore: Wenn mit diesen Gedichten die Macht des Leisen aufgerufen wird, so scheint einem solchen Unternehmen wenig Berechtigung beschieden in einer Zeit, die noch widerklingt von dem dröhnenden Nachhall ihres unbarmherzigsten Unwetters. Müssen solche Gedichte in unserer Welt der Trümmer, auf der Schädelstätte menschlichen Leides nicht wie ein Anachronismus wirken? Denn es sind Gedichte, in denen nichts als subjektive lyrische Aussage lebendig ist, persönliches Schicksal einer sensiblen und romantischen Frauenseele, in ihrer Verletzlichkeit etwa der Günderode benachbart, zerbrechlicher und wohl auch enger im Fraulichen verhaftet als die Droste – und doch beiden Frauen nicht allein durch lose Zeitgenossenschaft verbunden. Gewiß, einzelnes aus den zehn Gedichtbänden, die zu Lebzeiten der Dichterin von ihr in Druck gegeben worden sind, will uns heute allzu ichbezogen dünken, erweckt kaum mehr als den Eindruck verliebter Versenkung in die schmerzlich-süße Bitternis ihres Geschicks, vermag uns nur als ein zärtlicher Kult mit dem Leiden anzusprechen. In den weitaus meisten ihrer Schöpfungen aber findet diese Frau Verse von einer bezwingenden Eindringlichkeit des Fühlens, weiß um die Kunst der leisen Zwischentöne im Ausdruck, wie es sonst nur den Größten ihres Jahrhunderts vergönnt war. Und sie besitzt – was in der französischen Dichtung sehr selten ist – die liedhafte Ursprünglichkeit der Stimmung. Ein Leben voller Trauer und Prüfungen und als dessen Auftakt ein tragisches Liebeserlebnis in der Jugend: der Schmerz darüber, von einem mit allen Sehnsüchten ihres Wesens geliebten Manne hintergangen und – was ihr mehr gilt – nicht geliebt worden zu sein, läßt diese Frau Trost und Zuflucht im Wort finden: sie wird zur Dichterin. Allzu schmal mag manchem solche Basis ihres Dichtertums erscheinen, entscheidend bleibt, daß eine flutende Fülle unvergänglicher Verse daraus entstammt; wollen wir den Strom, der ein ganzes Land fruchtbar macht, nach seiner Quelle im Berggestein fragen? Wenn heute der durch blinde Torheit sehr zum Nachteil deutschen Wesens lange verriegelte Zugang zum reichen Bildersaal des französischen Geistes wieder gesucht wird, erinnere man sich, daß Verlaine diese dichtende Frau die größte in der französischen Poesie genannt hat und daß vor fünfundzwanzig Jahren Stefan Zweigs unvergessene Würdigung ihres tragisch beschatteten Erdenweges nur die wenigsten erreichte. So schien von mehreren Seiten her die Rechtfertigung für dies schmale Büchlein gegeben. Eine Übernahme der Dichtungen in den deutschen Sprachraum war nicht möglich, ohne zu dem besonderen Ausdruck der Marceline Desbordes die deutschen Entsprechungen in ihrer Zeit, eine romantisch-impressionistische Formenwelt in Bild und Sprache aufzusuchen. Der Übersetzer hat es als seine Aufgabe betrachtet, eine möglichst schlichte Form für einen Lied gewordenen «crève-coeur» zu finden, dessen mütterlich-weibliche Hintergründe, fern allem literarischen Ehrgeiz, durch ihr echtes, anspruchsloses Gefühl auch heute noch zu ergreifen vermögen. Die schwebend-feinen Unterschiede zwischen dem franzözischen «coeur» und «âme» sowie dem deutschen «Herz» und «Seele», zweien der Lieblingsbegriffe der Marceline, mußten dabei in mannigfachen Abstufungen wiedergegeben werden. Haben sie doch auch in der Terminologie der Dichterin selber einen Wandel durchgemacht. «Les fleurs amères» möchte man, Baudelaires schönen Titel abwandelnd, dieses Bändchen heißen und Blüten des Leides wahrlich sind die Strophen der unglücklichen Frau in einem sehr edlen Sinne. Daß ihr das Leid mehr bedeutete als dumpf verhängtes Schicksal, daß es Kräfte des Geistes und der Seele frei werden ließ, die in ihrer Mütterlichkeit auch uns zur Tröstung dienen können, daß aus dem Leide in Wahrheit «Blüten» sproßten, möge dieser Versuch einer Nachdichtung erweisen. Karl Schwedhelm

Autor:
Schwedhelm, Karl , Sachs, Nelly ,
Briefwechsel und Dokumente
(Werke Band 6)
64 S., geb., 1998
Der Briefwechsel mit Nelly Sachs umfaßt die Jahre von 1958 bis 1969. In der Werkausgabe Karl Schwedhelms sind zwei Essays über Nelly Sachs enthalten. Bisher ist nur bekannt und dokumentiert, daß er mit Gottfried Benn korrespondiert und dessen Werk regelmäßig besprochen hatte. Beim vorliegenden Briefwechsel mit Nelly Sachs können die Rezensionen in ihrer werkbegleitenden Funktion nicht mehr nachgewiesen werden. Vielleicht läßt sich dies aber aufgrund entsprechender Hinweise und Belege nachholen. Offensichtliche Flüchtigkeits- und Interpunktionsfehler wurden behutsam korrigiert. Der Kommentar wurde im Anhang untergebracht und nicht den Briefen beigegeben, damit diese nicht, wie so oft, von Herausgeberwissen überwuchert werden. Wer sich im Werk von Nelly Sachs auskennt, kann ohnehin darauf verzichten. Den anderen möge er erste Verstehenshilfe sein.

Autor:
Schwedhelm, Karl
Briefe und Texte
(Werke Band 7)
64 S., geb., 2003
Daß Karl Schwedhelm mit Gottfried Benn und Nelly Sachs eine ungewöhnliche literarische Freundschaft verband, dokumentieren bereits zwei Bände seiner Werkausgabe. Um fünf weitere Autoren will die vorliegende Sammlung diese Facette erweitern. Gerade weil die Freundschaft zu Paul Celan und Claire Goll nicht von Dauer war, richtet sich das Augenmerk des Nachwortes auf die heute sogenannte und immer noch erklärungsbedürftige Paul Celan – Claire Goll-Affäre. Aus dem Inhalt: Briefe: Celan / Schwedhelm bisher unveröffentlichte Briefe Claire Goll / Schwedhelm Hans Bender: Karl Schwedhelm, der Mann der Kunst, des Wissens und der Freundschaft Gerhard Neumann: Erinnerungen Briefe: Karl Schwedhelm an Gerhard Neumann Dieter Hoffmann: Ein Freund kalter Getränke Briefe: Karl Schwedhelm an Dieter Hoffmann Bernhard Albers: Nachwort
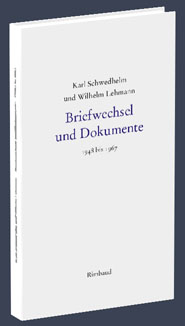
Autor:
Schwedhelm, Karl , Lehmann, Wilhelm ,
Karl Schwedhelm und Wilhelm Lehmann.
Mit Anmerkungen und einem Nachwort
herausgegeben von Klaus Johann.
Mit einem Lebenslauf Karl Schwedhelms von Sabine Schwedhelm
(Werke Band 8)
192 S., geb., 2007
Der Briefwechsel zwischen Wilhelm Lehmann (1882–1968) und Karl Schwedhelm (1915–1988) aus den Jahren 1948 bis 1967 ist nach denen mit Gottfried Benn und Nelly Sachs der dritte umfangreiche Briefwechsel Schwedhelms, der publiziert wird. Ähnlich wie Benn hatte Lehmann auch für Schwedhelms eigenes Schaffen eine große Bedeutung. Schließlich galt Lehmann in der Zeit dieses Briefwechsels mit seiner Lyrik vielen Kritikern und Literaturwissenschaftlern als durchaus gleichrangiger Antipode einerseits Benns und andererseits Bertolt Brechts. Neben den Briefen der beiden Autoren enthält das Buch auch Artikel, Radiosendungen, Rezensionen und einen Brief Schwedhelms über Lehmann, sowie einen Text Lehmanns zu Schwedhelms Gedichtband «Fährte der Fische». Darüber hinaus werden zahlreiche persönliche Kontakte und Begegnungen angesprochen und in den Anmerkungen ausführlich erläutert, so daß deutlich wird, daß das literarische Leben jener Zeit weitaus vielfältiger und nuancenreicher war, als es manche Literaturgeschichte glauben machen will.

Autor:
Strauß, Ludwig
Gedichte (1935)
95 S., fadengeh. Brosch., 1991
Immer schaun die heilige Stadt Unzählige Tote Durch ihre weißen Steine an, Gegenüber gelagert. Berg der Lebenden, Berg der Toten Ein Tal nur trennt sie. Die Gedichte von «Land Israel» entstanden 1934 unter dem unmittelbaren Eindruck einer Palästinareise. Sie wurden noch 1935 in Deutschland im jüdischen Schocken-Verlag (Berlin) veröffentlicht.

Autor:
Whitman, Walt
Zweisprachige Fassung der Erstausgabe von 1855
(englisch/deutsch)
Übersetzt von Walter Grünzweig und einer Gruppe von Übersetzern und Übersetzerinnen an der TU Dortmund.
226 S., Leineneinband, fadengeheftet 2022
AMERIKA verwirft nicht die Vergangenheit oder was sie in ihren Formen aus einer anderen Politik oder der Idee der Kasten oder der alten Religionen hervorgebracht hat .... akzeptiert die Lektion der Gelassenheit ... ist nicht so ungeduldig da man doch annehmen musste dass der Schorf noch an den Meinungen und Umgangsformen und der Literatur haftet während das Leben das den Anforderungen der Vergangenheit genügte in das neue Leben mit neuen Formen gewandert ist ...
Nachtgedicht [Auszug] DIE GANZE NACHT lang streifte ich in meinem Traumbild umher, Auf leichten Füßen .... flink und lautlos bewege ich mich und halte an. Beuge mich offenen Auges über die geschlossenen Augen der Schläfer; Umherstreifend und verwirrt .... verloren in mir selbst ... schlecht aufgestellt .... widersprüchlich Halte inne und schaue und beuge mich und stehe still. Wie würdevoll sie da aussehen, ausgestreckt und ruhig; Wie ruhig sie atmen, die kleinen Kinder in ihren Wiegen.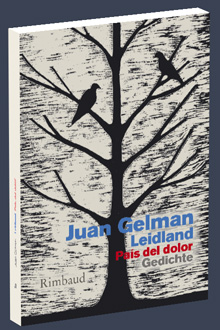
Autor:
Gelman, Juan
Gedichte
zweisprachige Ausgabe spanisch/deutsch
Aus dem Spanischen ausgewählt und übertragen und mit einem Vorwort von Walter Eckel
176 S., Klappenbrosch., 2017
Was ihm sein Heimatland Argentinien an Leid zumutete, geht weit über das hinaus, was Menschen gemeinhin zu ertragen vermögen. Dass Gelman nicht an seinem Schicksal zerbrach, hat er vor allem der Poesie zu verdanken. So hinterfragt er auch in seinen späten Gedichten das grausame Geschehen unter der Militärdiktatur und dessen schwierige Aufarbeitung nach der Rückkehr zur Demokratie. Neben dem Leid und der Poesie kreisen seine Gedichte um die Themen Kindheit, Liebe, Tod und soziale Gerechtigkeit, die er immer wieder aufgreift und aus anderen Perspektiven beleuchtet. Gelmans Dichtkunst – «Die Bäume zeigen ihr Alphabet», heißt es im Gedicht «Neuigkeiten» (S. 119) – reicht von einem «gesprochenen Guernica» (Jorge Boccanera) bis hin zu feinsinnigen und schönen, meist seiner zweiten Frau Mara gewidmeten Liebesgedichten. Wer von einem politischen Kopf wie Gelman politische Lyrik im Stile des sozialistischen Realismus eines Louis Aragon erwartet, wird enttäuscht sein; wer hingegen Sinn hat für außergewöhnlichen Bilderreichtum, eingebettet in eine fein gewobene Alltagssprache, wird bei Gelman seine Freude haben: Jemand gießt die Sterne, und das Holz wächst. («Herbsten»)
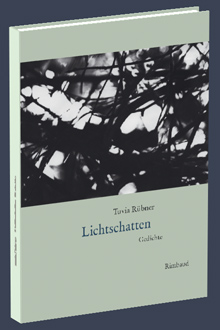
Autor:
Rübner, Tuvia
Gedichte
Mit einem Nachwort von Bernd Albers
102 S., geb., 2011
«Lichtschatten» ist ein Buch voll von Paradoxen, aber je älter Rübner wird, desto leichter und klarer, ja selbst heiterer werden seine Verse: als wäre das Gedicht selbst ein Ausweg aus der auswegslosen Symmetrie des Paradoxes.
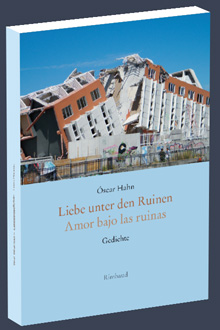
Autor:
Hahn, Óscar
Gedichte
spanisch/deutsch
Aus dem Spanischen ausgewählt und übertragen und mit einer Einführung von Walter Eckel
1 Abb., 132 S., Klappenbrosch., 2. Aufl. 2016
Óscar Hahn ist Autor und Herausgeber zahlreicher Bücher über die lateinamerikanische Literatur. Zu seinen wichtigsten Gedichtbänden zählen Arte de morir (1977), Mal de amor (1981), Versos robados (1995), Apariciones profanas (2002), En un abrir y cerrar de ojos (2006), Pena de vida (2008), La primera oscuridad (2011). Seine Gedichte wurden in mehrere Sprachen übersetzt und in zahlreiche Anthologien aufgenommen. Óscar Hahn wurde für sein lyrisches Werk vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem chilenischen Altazor-Preis, dem spanischen Literaturpreis Casa de América und dem kubanischen Lezama-Lima-Preis. Erst kürzlich wurde ihm der renommierte Iberoamerikanische Poesiepreis Pablo Neruda verliehen. Der chilenische Literaturnobelpreisträger Pablo Neruda hatte seiner Lyrik schon früh «große Intensität und Originalität» bescheinigt, ein Urteil, das auch vom peruanischen Nobelpreisträger Mario Vargas Llosa geteilt wird, der das Werk Hahns als «großartig und wahrhaft originell» und als «das Persönlichste, das mir in der Lyrik unserer Sprache seit langem begegnet ist» bezeichnete.
Autor:
Meister, Ernst
Liebesgedichte von Ernst Meister
Herausgegeben und mit einem Nachwort von Reinhard Kiefer
(Sammlung Luchterhand 957)
83 S., Klebebindung 1991
Ernst Meister war ein Dichter der letzten Dinge. Ihn beschäftigte der Grund unseres Daseins, und damit auch die Liebe, ein Leben lang. In seinen puritanisch knappen Versen nahm er keine Rücksicht auf Moden. Die Liebesgedichte, die Ernst Meister in über 40 Jahren geschrieben hat, finden sich in diesem Band versammelt. Sarah Kirsch über Ernst Meister: "Seine Gedichte, die natürlich das Gegenteil von Lebenshilfe sind, eher Mutproben, gehen wie schwarze Choräle eines, der versucht an das Unbekannte zu denken, uns durch den Leib. Wir gelangen weiter in ihnen, indem wir ohne Eitelkeit beginnen, und es bedarf schon einer gewissen Demut. . . Einen geringen Trost vermag er ja auch zu geben. 'Am Ende sagt von Zweien der Eine noch: ich hab dich eingelebt in die Verlassenheit'."
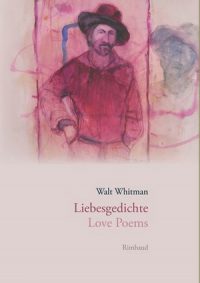
Autor:
Whitman, Walt , Schablewski, Frank ,
englisch / deutsch
Ausgewählt und übertragen von Frank Schablewski
Vorwort von Johannes Urzidil
Nachwort von Walter Grünzweig
128 S., gebunden, Fadenheftung
3. Aufl. 2021
In der großen Sinnlichkeit und geradezu überbordenden Körperlichkeit, die von Whitmans Gedichten ausgehen, können Parallelen zu den eigenen Gedichten des Übersetzers Frank Schablewski gesehen werden. Von daher sind die ausgewählten Liebesgedichte Ausdruck einer ganz persönlichen Sammlung. Ein Vorwort von Johannes Urzidil und ein Nachwort von Jürgen Brôcan begleiten diese Ausgabe und geben bedeutende Einblicke in die Zeit und das Wirken von Walt Whitman.

Autor:
Kiefer, Reinhard
gedichte
64 S., geb., 1997

Autor:
Ponnelle, Pierre-Dominique
mit einem Text von Wolf Wondratschek
enthält Abbildungen
Klappenbroschur
47 S.; 2019
"Als junger Musiker hätte ich es mir nicht träumen lassen, daß mich mein Weg nach Osten führen würde. Was anfangs, durch die schwierigen Bedingungen, wie eine Härte wirkte, entpuppte sich als Glücksfall. Dank der vielen wunderbaren Menschen, denen ich begegnen durfte, und dank der reichen und mannigfaltigen Kultur fühle ich mich bereichert, und bin dankbar."

Autor:
Kiefer, Reinhard
Ernst Meister Studien Bd. 1
Die negative Theologie im lyrischen Werk Ernst Meisters
352 S., geb., 1992
Ernst Meister Studien Bd. 2
von Theo Buck
Die Tagungsbeiträge
Mit einem Vorwort von Anke Brunn
Mit Beiträgen von Helmut Arntzen, Theo Buck, Norbert Gabriel, Paul Good, Reinhard Kiefer, Beate Laudenberg, Thomas Althaus, Jürgen Egyptien, Ewout van der Knaap, Ulrich Prill, Christian Soboth, Bernhard Albers, Gerrit-Jan Berendse, Walter Gödden, Ton Naaijkens
264 S., geb., 1993
Ernst Meister Studien Bd. 3
Marc Houben und Francoise Lartillot
Ein Verzeichnis
96 S., geb., 1995
Ernst Meister Studien Bd. 4
Redaktion Thomas Althaus
Die Tagungsbeiträge
Mit einem Vorwort von Helmut Arntzen
Mit Beiträgen von Theo Buck, Andreas Lohr-Jasperneite, Maria Behre, Richard Dove, Christian Soboth, Cordula Braun, Stefan Matuschek, Beate Laudenberg, Jürgen Kiel, Eckehard Czucka, Ewout van der Knaap, Thomas Althaus, Jürgen Egyptien, Reinhard Kiefer, Andreas Kautz, Fatma Massoud, Ursula Heindrichs, Ludwig Völker, Monika Schmitz-Emans, Wolfgang Braune-Steininger, Gerrit-Jan Berendse, Horst Meixner
400 S., fadengeh. Brosch., 1996
1993 in Münster
Ernst Meister Studien Bd. 5
von Andreas Kautz
392 S., geb., 1998
Ernst Meister Studien Bd. 6
von Johann Klaus
Zu einer Gedichtsequenz Ernst Meisters
276 S., geb., 2000
Bei uns vergriffen! Out of print!
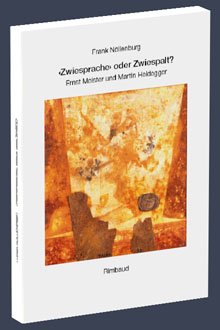
Ernst Meister Studien Bd. 7
Ernst Meister und Martin Heidegger
168 S., brosch., 2004
Bei uns vergriffen! Out of print!
Dass Ernst Meisters Lyrik auch und vor allem als poetische Applikation der Philosophie Martin Heideggers zu lesen sei, gilt bis heute in weiten Teilen der Forschung als ausgemacht. Ein Vergleich der Verwendung gängiger existenzphilosophischer Termini bei Meister und Heidegger zeigt jedoch, dass Meister diese Begriffe konsequent anders deutet und sich zumeist in den konzeptionellen Bahnen bewegt, die bei Heidegger auf das Schärfste kritisiert werden. Diesem Befund entsprechend deuten auch die wenigen expliziten Äußerungen Meisters zu Heidegger nicht auf eine herausragende Bedeutung des Philosophen für den Dichter. Vielmehr drängt sich der Verdacht auf, dass die Verbreitung genannter Ansicht Effekt des philosophischen und methodologischen Einflusses Heideggers auf die Ernst-Meister-Forschung ist.
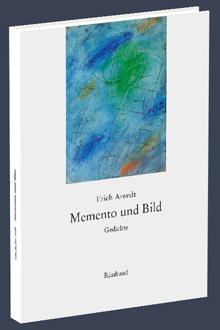
Autor:
Arendt, Erich
Gedichte (1976)
(Sämtliche Gedichte Bd. 8)
hrsg. von Gerhard Wolf
112 S., geb., 2007
Erinnerung als Mahnung in den Vers, Erlebt-Erfahrenes ins Bild zu bringen, das besagt schon der sachlich-spröde Titel von diesem Gedichtband Erich Arendts, entstanden in den Jahren 1967 bis 1976. Arendt teilte sich schon von ersten Versentwürfen gern einem Adressaten mit, Zustimmung oder Zweifel herausfordernd, auf Einspruch geradezu erpicht, eigene Gewißheit oder Bedenken schon von Beginn an ins Gespräch, in Disput zu bringen, um das Gedicht zu der Gestalt voranzutreiben, die er gelten ließ – jedenfalls bis zum Zeitpunkt des Drucks.

Autor:
Vallejo, César
Gedichte (spanisch / deutsch)
Werke Bd. II, übersetzt von Curt Meyer-Clason,
hrsg., mit Anmerkungen und einem Nachwort von Alberto Perez-Amador
1 Abb., 316 S., geb., 2. Aufl. 2010
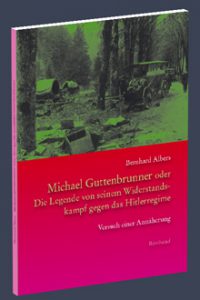
Autor:
Albers, Bernhard , Guttenbrunner, Michael ,
Mit einem Text von Reinhard Kiefer
10 Abb., 44 S., Klappenbrosch., 2012
Die Wehrmachtsakten im Österreichischen Staatsarchiv lassen keinen Zweifel daran, daß Guttenbrunner weder aktiv gegen das Hitlerregime Widerstand leistete, noch aus diesem oder einem anderen Grunde zum Tode verurteilt wurde. Verliert daher seine Dichtung an Glaubwürdigkeit? Mit diesem Buch versucht der Verleger Michael Guttenbrunners, der dessen Spätwerk (Im Machtgehege II–VIII) anregte, eine Antwort zu geben.
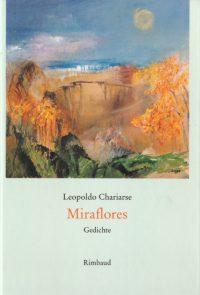
Autor:
Chariarse, Leopoldo
Gedichte spanisch / deutsch
76 S., geb., 2. Auflage 2020
Leopoldo Chariarse wurde 1928 in Peru geboren. Er studierte in Lima Ethnologie und Literatur und an der Sorbonne Musikwissenschaft, an den Konservatorien Lima und Köln Harfe, Laute und Gitarre. Auf Indien-Reisen kam er mit Yoga und Praktiken der Meditation in Berührung. Heute leitet er in Düsseldorf ein kulturübergreifendes Institut, die Gesellschaft für Geisteswissenschaftliche Fortbildung, die sich mit indischen und fernöstlichen Traditionen befaßt, aber auch Konzerte mit Musik aus asiatischen und südamerikanischen Ländern veranstaltet. 1952 veröffentlichte er «Los ríos de la noche» (Die Flüsse der Nacht). Danach wurde er führendes Mitglied der «50er Generation». Es folgte «La cena en el jardín» (Das Abendessen im Garten, 1975). Im Jahre 1988 erschien als spanisch-deutscher Paralleltext «Margen de la nostalgia» (Ufer der Sehnsucht), 1998 wurden die «Elegías» veröffentlicht, 1999 «Los sonetos» und 2000 «Solsticio» (Sonnenwende). Chariarse zeigt sich als vielseitiger Lyriker: er beherrscht zum einen klassische Formen wie das Sonett, zum andern schwelgt er in freier Lyrik unter Verzicht auf Satzzeichen, so daß der Leser angesichts der dadurch entstehenden Mehrdeutigkeit hin- und hergerissen ist. Bald aber überträgt sich die Seelenruhe, die das gesamte Werk durchzieht, auf den Leser. Und es ist diese innere Ruhe, mit der der Dichter Gedanken auszudrücken vermag, wie dies nur in lyrischer Kodierung gelingt. Kennzeichnend für sein Werk ist auch die Musikalität, die sich unter anderem in der Praxis des Einrückens zeigt, wo er durch musikalische Stilmittel wie Zäsuren und Kadenzen bestimmte Satzteile hervorheben kann. Obwohl er viele Reisen unternahm und zahllose Eindrücke aufnehmen konnte, zeigt sein Schaffen Kontinuität, Geradlinigkeit und Zielstrebigkeit. Sehnsucht und Elegie sind Merkmale, die sein Werk prägen. Das Sehnsuchtsmotiv tritt besonders in dem 2007 verfaßten Gedicht «Mis trapecios inmóviles» (Meine unbeweglichen Trapeze) zutage, inspiriert von seiner Liebe zum Zirkus, der ihn als Jugendlichen so begeisterte.

Autor:
Meister, Ernst
Supplementband 1
Mit einem Nachwort von Reinhard Kiefer
192 S., fadengeh. Brosch., 2000
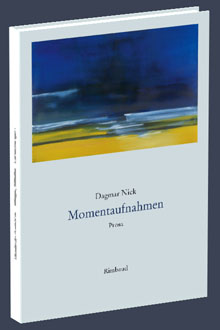
Autor:
Nick, Dagmar
Prosa
92 S., geb., 2. Aufl. 2015
I Zwischenzeit Offene Texte Protokoll einer Grabrede II Donnerstagabend, Ophelia Bilanz Brief an Lina Morgenstern Beflügelte Jahre Momentaufnahmen bei einer Gruppenfahrt durch die Provence Der Empfang des Dichters Lustgewinn oder Das ewige Leben Die Boten III Meine unvergessenen Lehrer Gedenkblatt für Rosi Hazór, erinnert
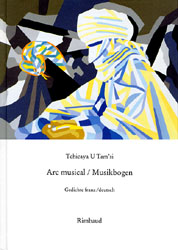
Autor:
U Tam’si, Tchicaya
Gedichte (französisch / deutsch)
(Werke Bd. III)
hrsg. und mit einem Nachwort von Hans-Jürgen Heinrichs
128 S., geb., 1999
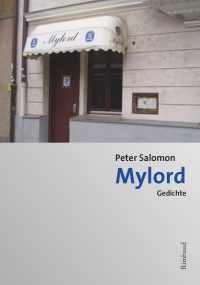
Autor:
Salomon, Peter
schwule Gedichte
1972-2019
45 S., broschiert mit Klappen, 2019
Für Frank
Ich hänge die Jacke weg.
Liebe läßt immer paar Kleider zurück.
Seine Jacke also hängt
Jetzt in meinem Schrank.
Kommt er wieder, ist er froh
Über die verloren geglaubte Jacke.
Peter Salomon hat in seine Gedichtbände immer auch ein paar "schwule Gedichte" eingestreut, nie jedoch ein explizit schwules Buch gemacht. Im vorliegenden Band sind diese verstreut erschienenen, zwischen 1972 und 2019 entstandenen Gedichte gebündelt. Es handelt sich um "Klartext-Gedichte", die deutlich aussprechen, was Sache ist.
"Seine 'schwulen Gedichte' sind nämlich verzauberte Wunderdinge: melancholisch und witzig, poetisch und sexy."
-Thomas Ott
"Lyrisch, schnörkellos, schwul" - Eine Besprechung von Stefan Hölscher für queer.de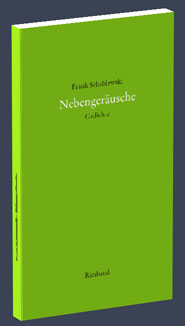
Autor:
Schablewski, Frank
Gedichte
64 S., fadengeh. Brosch., 2005
vom Wasser keine Spur führt zu dem Wolkenfeld
ein Gegengewicht von Flugsand und Grabstein im Hafen schaukelt ein Fährschiff die Paar Älteren mit Kind zum Auslaufen bereit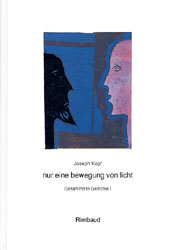
Autor:
Kopf, Joseph
Gesammelte Gedichte Bd. I – 1952–1963
(Hrsg. von Paul Good)
192 S., geb., 1992
Die «Gesammelten Gedichte in zwei Bänden» machen erstmals (mit Ausnahme des jugendlichen Frühwerkes) das gesamte von Joseph Kopf selber verstreut veröffentlichte Hauptwerk in der historischen Gestalt und Abfolge zugänglich.
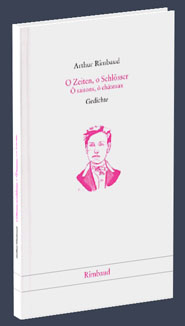
Autor:
Rimbaud, Arthur
Gedichte (französisch / deutsch)
(Werke Band 2)
übertragen von Thomas Eichhorn
72 S., geb., 1992
O Zeiten, o Schlösser, welche Seel ist ohne Fehl? O Zeiten, o Schlösser, Ich forschte nach dem Zauberzeichen Des Glücks, dem niemand kann entweichen. Es lebe hoch, ein jedes Mal, Wenn Gallien hört des Hahnes Schall. Thomas Eichhorn erhielt für seine Neuübersetzung den André-Gide-Preis für deutsch-französische Literaturübersetzungen.
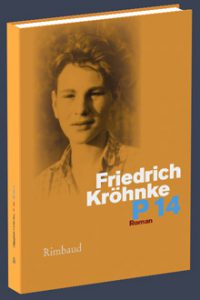
Autor:
Kröhnke, Friedrich
Roman
Neuauflage (früher Ammann Verlag)
192 S., geb., 2014
"… von der ungleichen Liebe zwischen einem promovierten West-Berliner Mittdreißiger und einem Ost-Berliner Jungen …"
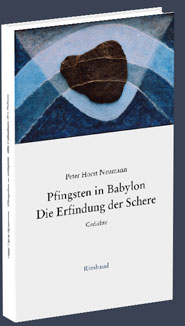
Autor:
Neumann, Peter Horst
Gedichte
160 S., geb., 2005
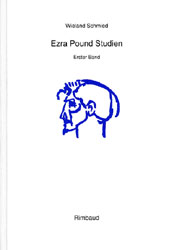
Ezra Pound Studien I
von Wieland Schmied
12 Abb., 96 S., geb., 2000
Der Band enthält die Aufsätze: «Ezra Pound – Größe, Schuld und Tragik eines Dichterlebens», «Vortex und Rock drill – Ezra Pound und der Bildhauer Jacob Epstein», «Ezra Pound, Wyndham Lewis und der Vortizismus». … Das neue Büchlein, gedacht als Anfang einer Sammlung der Pound-Studien, bringt drei Arbeiten zum unerschöpflichen Thema. Die erste – ein Vortrag über «Größe, Schuld und Tragik eines Dichterlebens» – bündelt noch einmal Pounds menschliche und politische Problematik. Gegen die Dr.-Jekyll-und-Mr.-Hyde-These, die den Dichter exkulpiert, setzt Schmied den Satz: «Es gibt nur einen Pound»… Der Vortizismus, zu dessen Wortführern neben Wyndham Lewis und Henri Gaudier-Brzeska Ezra Pound gehörte, verstand sich als Gegenbewegunf zum Futurismus. Gott oder Teufel – gerade bei Pound stecken sie im Detail. Und so bewegt sich der Essayist und Kunsthistoriker Schmied am glücklichsten dort, wo er Phänomene der Poesie und der bildenden Kunst zusammen schauen kann …
Autor:
Hoghe, Raimund
Erzählung
99 S., brosch., 1984
«Gesprochen hat sie nie über ihn. Es war, als habe sie mit dem Sohn eine Übereinkunft getroffen. Sie sprach nicht über ihn, und er fragte nicht nach dem Vater. Nur einmal glaubte er, ihn gesehen zu haben, flüchtig, auf dem Flur, die Treppe hinuntergehend. Die Sehnsucht und Angst, daß der Fremde eines Tages wiederkäme, behielt er für sich.» Daß er ihre große Liebe war, war kein Geheimnis. Das mußte sie nicht wiederholen. Es zu tun, wäre ihr wie Verrat vorgekommen, schreibt Raimund Hoghe in seiner Geschichte «Preis der Liebe», in der er Spuren und Spiegelungen dieser Liebe im Deutschland der fünfziger und sechziger Jahre aufzufinden sucht.
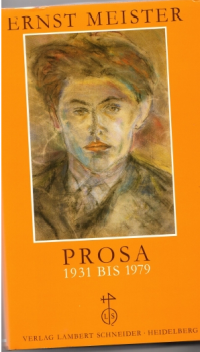
Autor:
Meister, Ernst
60. Veröffentlichung der Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung Darmstadt
368 S., geb., 1989
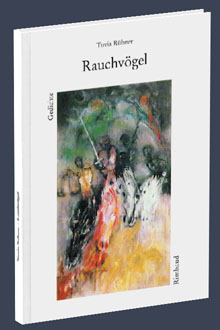
Autor:
Rübner, Tuvia
Ausgewählte Gedichte I (1957–1997)
64 S., geb., 1998
Mutter am Grab ihres Sohnes
Sohn, Sohn gebeugt über dich bist ein Stein in meinem Schoß wie Feuer bin ich in deinem Blut erkaltet, erkaltet. Dein kalter Blick ist Feuer in meinem Blut. Stein bin ich, du in meiner Hut.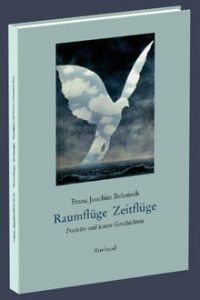
Autor:
Behnisch, Franz Joachim
Porträts und kurze Geschichten
mit einem Nachwort von Ehrentraud Dimpfl
112 S., geb., 2007
Themen seiner Romane, Erzählungen, Hörbilder, Kurzprosa und Lyrik sind vor allem Berlin und die Zeitgeschichte.
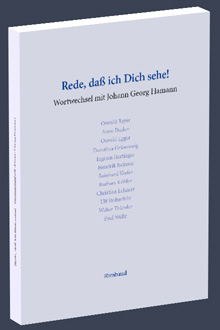
Hrsg. von Susanne Schulte
Mit Beiträgen von Oswald Bayer, Reinhard Kiefer, Christian Lehnert, Anne Duden, Dorothea Grünzweig, Walter Thümler, Oswald Egger, Ingram Hartinger, Barbara Köhler, Paul Wühr, Hendrik Jackson, Ulf Stolterfoht.
176 S., Klappenbrosch., 2007
Vielgeliebter Leser! ich heiße der Magus in Norden – Königsberg 1730–56: Johann Georg Hamann wird 1730 als Sohn eines Baders und Wundarztes geboren – Studium der Rechtsgelehrsamkeit zum Schein, Selbststudium der Philologie, Philosophie, Volkswirtschaft – Hauslehrer auf baltischen Gütern. Riga/London 1756–58: Angestellter beim Handelshaus Berens in Riga – mit handelspolitischem Auftrag in London gescheitert – Bohemien überm Abgrund, ein schwuler Junker hält ihn aus: Ich war der Verzweiflung nahe und suchte in lauter Zerstreuungen selbige zu unterdrücken. Ich fraß umsonst, ich soff umsonst, ich buhlte umsonst, Völlerei und Nachdenken, Lesen und Büberei, Fleiß und üppiger Müßiggang wurden umsonst abgewechselt. Ich änderte fast monatlich meinen Aufenthalt, ich fand nirgends Ruhe. – Bekehrung und Wiedergeburt beim Lesen der Bibel: Ich vergaß alle meine Bücher darüber, ich schämte mich, selbige gegen das Buch Gottes jemals verglichen zu haben. Ich erkannte meine eigenen Verbrechen in der Geschichte des jüdischen Volks, ich las meinen eigenen Lebenslauf. Königsberg 1759–87: Schriftsteller und Publizist als Kreuzes-Philologe, als Diener des göttlichen Wortes, Denker des Logos und der Sprache, Kritiker abstrakter Vernunft , Advokat der Leiblichkeit und der Individualität – wilde Ehe mit Anna Regina Schumacher, vier Kinder – Zollbeamter im Königsberger Hafen und «homme de lettres», Armut: … in meinem Haus, wo alles wüste, verstört ist – und kein halbes Dutzend ganzer Stühle. Ich bin auch in meinem ganzen Leben zu keinem ordentlichen Anzuge de cap a pied gekommen, habe umsonst bisweilen Versuche gemacht, dies zu erreichen – Ruhm: als «Magus in Norden» im deutschen Sprachraum verehrt. Westfalen 1787–88: bei Friedrich Heinrich Jacobi in Pempelfort, Franz Kaspar Bucholtz und der Fürstin Amalie von Gallitzin in Münster: Ich lebe hier im Schoße der Freunde von gleichem Schlage, von gleichem Gelichter und die sich wie Hälften zu meinen Idealen der Seele passen. Ich habe gefunden und bin meines Fundes so froh, und wenn es einen Vorgeschmack des Himmels auf Erden gibt, so ist mir dieser verborgene Schatz, diese köstliche Perle zu Teil geworden. – Tod am 21.06.1788 in Münster. «Rede, daß ich Dich sehe!» – so forsch wie respektvoll fordert Johann Georg Hamann, der «Kreuzesphilologe» aus Königsberg, der 1788 in Münster starb, seinen Gott auf, sich in der Welt, im Buch der Bücher sowie in den Büchern der Natur und der Geschichte zu offenbaren. Auch die Dichtung bezieht Hamann in seine heilsgeschichtliche Universalhermeneutik ein. Sie soll restituieren, was Ratio und Rationalismus zerstören, indem sie das Selbst und seine Welt zur Sprache bringt und dadurch allererst sichtbar macht: «Rede, daß ich dich sehe!» Ein religiöser Sprachdenker und Hermeneutiker durch und durch, weist Hamann zugleich auf das Barock und die Postmoderne. Von ihm her, der als einer der ersten und schärfsten Kritiker der Aufklärung von den Intellektuellen seiner Zeit hoch geschätzt, dennoch einer der «großen Vergessenen der Kulturgeschichte» (Schleiferboom) ist, gewinnt das Projekt der Säkularisierung Kontur. Und die Ästhetik des Magus bietet noch heute der Poesie und Poetik eine ideale Reibungsfläche. Elf Schriftsteller und Schriftstellerinnen sowie ein Theologe setzen sich in Originalbeiträgen mit dem Denken und Schreiben Johann Georg Hamanns auseinander. Der Kreuzesphilogoge provoziert noch heute, zum Quer- und Weiterdenken und -dichten, zum konstruktivistischen Widerspruch, zur emphatischen Bejahung. Blindheit und Trägheit des Herzens ist die Seuche, an welcher die meisten Leser schmachten […]. Die beste Welt wäre längst ein totes Meer geworden, wenn nicht noch ein kleiner Same von Idio- und Patrioten übrig bliebe, die ein hapax legomenon bogenlang wiederkäuen, zwo Stunden bei Mondschein zu Übersetzungen, Anmerkungen, Entdeckungen unbekannter Länder widmen, ohngeachtet sie des Tages Last und Hitze ertragen haben; – & calices poscunt maiores um nach verrichteter Arbeit und empfangenem Lohn den deutschen Kunstrichtern eine gute Nacht zu wünschen. Johann Georg Hamann
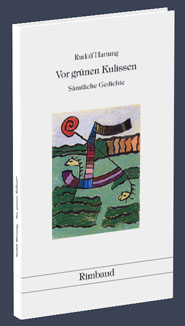
Autor:
Hartung, Rudolf
Sämtliche Gedichte
(Werke Band I)
1 Abb., 96 S., geb., 1990
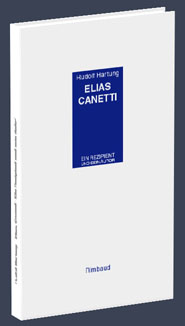
Autor:
Hartung, Rudolf , Albers, Bernhard ,
(Werke Band II)
159 S., geb., 1992
Hartung hat als Lektor des Weismann Verlages 1948 nicht nur die Wiederveröffentlichung von Canettis Roman «Die Blendung» betrieben, sondern darüber hinaus in singulärer Weise dessen Werk publizistisch begleitet.
Der Band enthält alle Rezensionen sowie unter anderem Auszüge aus dem unveröffentlichten Briefwechsel von Hartung und Canetti.Autor:
Hartung, Rudolf
(Werke Band III)
92 S., brosch., 1997
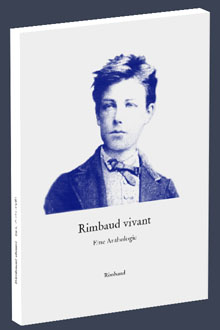
Autor:
Albers, Bernhard
Eine Anthologie
Hrsg. v. Bernhard Albers
96 S., fadengeh. Brosch., 2. veränderte Auflage 2004
Aus dem Inhalt: I. Mythos Rimbaud Klaus Mann: Arthur Rimbaud Hans Mayer: Arthur Rimbaud Bernhard Albers: Arthur Rimbaud und Oscar Wilde II. Rimbaud vivant Martin Heidegger: Rimbaud vivant Theo Buck: Rimbauds Ophelia-Gedicht und seine lyrische Rezeption bei Heym, Benn und Brecht Georg Heym: Die Tote im Wasser Georg Heym: Ophelia Gottfried Benn: Schöne Jugend Bertolt Brecht: Vom ertrunkenen Mädchen Peter Huchel: Ophelia Walter Hinck: Vom Tod in der Stacheldrahtreuse Christoph Meckel: Ophelia Hans Christoph Buch: Kein Fall von Nekrophilie III. Homme de lettres Erich Jansen: Arthur Rimbaud aus Charleville Peter Weiss: Rimbaud (ein Fragment) Reinhard Kiefer: Eine Sequenz Saint-Pol-Roux: Orpheus aus den Ardennen Ulrich Berkes: Rendezvous mit Rimbaud Ulrich Berkes: Ein Sommer in der Hölle Andreas Reimann: Rimbauds Ankunft Frank Schablewski: Delirien IV. Merde pour la poésie! Erich Arendt: Adua Karl Schwedhelm: Rimbaud in Luxor Ernst Meister: Seit jenem Scheitern Reinhard Kiefer: Poem VI Gerhard Neumann: Ein Unordentlicher
Autor:
Rimbaud, Isabelle , Rimbaud, Vitalie , Rimbaud, Arthur ,
Isabelle Rimbaud
Rimbauds letzte Reise
Vitalie Rimbaud
In London 1874
Nachwort und übersetzt von Curd Ochwadt
48 S., brosch., 1964
Das Tagebuch «In London 1874» der früh verstorbenen älteren Schwester Rimbauds zeigt ihn, schon gleichsam entschwindend, im Augenblick der Krise nach der letzten, nicht mehr genau bestimmbaren Beschäftigung mit seiner Dichtung. Die in Frankreich seit Jahrzehnten vergriffene «Letzte Reise» breichtet vom letzten Aufenthalt des Todkranken in seiner Heimat in den Ardennen, sowie von seiner verzweifelten letzten Fahrt in den Süden. Die Aufzeichnungen der beiden Schwestern bezeichnen den Fortgang des Dichters in die schweigsamen Jahre seiner Zurückgezogenheit am Roten Meer und die Rückkehr des Sterbenden, bei dem noch einmal, obgleich halb entrückt, das in der Abwendung bewahrte dichterische Denken Rimbauds aufleuchtet.
Autor:
Bender, Hans
Zwischen Hans Bender und Rainer Brambach
Herausgegeben von Hans Georg Schwark
Mit einem Vorwort von Michael Zimmermann
237 S., kartoniert
(Übernahme aus dem v. Hase Koehler Verlag)
Die Liebe zur Literatur hat sie zusammengeführt: Hans Bender , den Schriftsteller und Herausgeber in Mannheim und Köln, und Rainer Brambach, den Gartenbauarbeiter und Lyriker in Basel. Briefe über Bücher und Autoren, Freunde und Frauen, über den Beruf, den Alltag und was sie mehr bewegt als die Tendenzen oder Moden der Zeit: das Handwerk ihres Schreibens.
Spontante, heitere, traurige, ganz persönliche Briefe, die eindrucksvoll die Freundschaft dokumentieren und zudem Einblicke vermitteln in die Literaturgeschichte jener vergangenen Tage.
Autor:
Canetti, Elias , Albers, Bernhard ,
Briefe, Autobiographisches und Fotos
Aus dem Nachlaß von Elias Canetti
herausgegeben von Bernhard Albers
15 Abb., 80 S., Klappenbrosch., 2011
Elias Canetti über Rudolf Hartung Ich schreibe diese «Erinnerung» aus Berlin nieder, aber ich muss hinzufügen, dass ich trotz meiner Betroffenheit über sein Verhalten Hartung noch immer liebe. Es gibt, glaube ich, nichts, was ich ihm nicht leicht verzeihen könnte. Nicht nur bleibt alles bestehen, was er für mein Werk getan hat. Es ist wesentlich, und daran könnte niemand je rütteln, dass er es lange Jahre als Einziger getan hat. Man muss das umso mehr würdigen, als es sicher ist, dass mein Werk ihm nicht eigentlich liegt. Seine wahren Götter sind Thomas Mann und Henry James, mit denen ich überhaupt nichts, wirklich nicht das Geringste gemein habe. Er steht ganz zu Freud und lehnt darum sehr Vieles in «Masse und Macht» ab. Er liebt den Tod und gewiss verachtet er meinen krüden Todeshass. Meine Sicherheit und vielleicht auch meine Kraft muss ihn oft bedrücken, wie meinen Bruder Georg. Ich liebe ihn aber keineswegs nur wegen seiner kapitalen Verdienste um mein Werk. Ich liebe seine ganze Art, weil sie meiner so entgegengesetzt ist, das Tastende, Empfindliche, Balancierende seiner Natur, seine Schwermut, die Ähnlichkeit mit der Vezas hat, die Schwierigkeit seines Lebens, selbst seine Tücken und Gehässigkeiten, die er wie jeder hat, die ich früher übersah und jetzt in der Erinnerung erst als solche erkenne. Ich sollte vielleicht nicht bei ihm wohnen, weil ich ihm sehr auf die Nerven gehe. Es ist möglich, dass er sich schärfer gegen mich stellen wird, wenn ich wirklich berühmt sein sollte. Er hat einen wohltuenden Hass gegen alle Aufgeblasenheiten und unterwirft sich nie. Ich betrachte ihn als einen Freund, der mir gleichgestellt ist, und das ist keine mitleidige Fiktion wie in manchen anderen Fällen, das meine ich. Ich werde ihm nie für etwas grollen, was er gegen mich tut, selbst wenn es schmerzlich und unerwartet ist wie jene Nacht in Berlin.
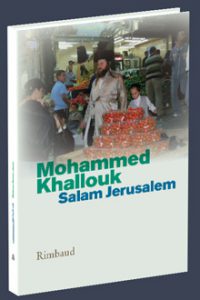
Autor:
Khallouk, Mohammed
Mit Fotos von Samy Charchira
19 farb. Abb., 62 S., geb., 2015
Dass weltoffene Muslime, wie Nicht-Muslime, Israel gegenüber Vorbehalte haben, ist als Ergebnis der langen muslimisch-jüdischen Konfrontation(en) nicht verwunderlich. Erfreulich ist es, wenn sich Menschen schließlich doch dazu durchringen, eigene Vorurteile durch eigene Anschauung und eigenes Denken zu überprüfen – und gegebenenfalls abzubauen. Mohammed Khallouk ist so ein Moslem, so ein Mensch. Er ist ein Mensch – und entdeckt auf diese Weise, dass Juden und Israelis Menschen wie du und ich sind. Michael Wolffsohn
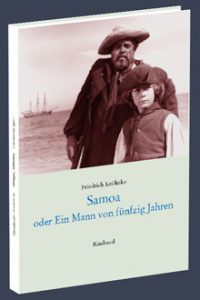
Autor:
Kröhnke, Friedrich
Roman
168 S., geb., 2006
"Es ist ein flirrendes Spiegelkabinett. Eine kunstvoll inszenierte Tragödie eines verstummten Künstlers... ein Spiel mit literarischen Motiven der Romantik - Spiegelbild, Widergänger, Teilung - und der Gegenwart."
-Alexander Kluy, Rheinischer Merkur
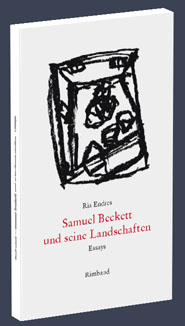
Autor:
Endres, Ria
Essays
Mit einem Nachwort von Elfriede Jelinek und Zeichnungen von Ingrid Hartlieb
80 S., fadengeh. Brosch., 2006

Autor:
Zins, Jaffa
Gedichte
Hrsg. und aus dem Hebräischen übs. von Konstantin Kaiser
in Zusammenarbeit mit der Autorin
Mit Übersetzungen von Manfred Winkler und Frederick Brainin
80 S., brosch., 2007
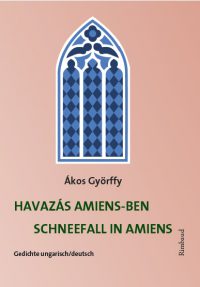
Autor:
Győrffy, Ákos
Gedichte
ungarisch/deutsch
64 S., 2020
Fadengeh., Klappenbroschur
Ákos Györffy wird von vielen als pantheistischer Dichter angesehen. Im Lyrikband Schneefall in Amiens entführt er den Leser zu traumhaften Touren in imaginierte Landschaften, eigentlich seine Lieblingsgebiete: Flussufer, von der Natur zurückeroberte Täler, der verlassene Weinberg, die menschenleere Meeresbucht – Koordinaten, zwischen denen es sich noch lohnte zu leben. Er befasst sich mit den quälendsten Fragen des Menschen in einer seiner unwürdigen Welt, sucht nach Ursachen und Verantwortlichen, weist Wege des Ausgangs. Den Gedichten wohnt Ehrlichkeit, Einfachheit, Schlichtheit inne. Mit leisen, zur Meditation anregenden Gedichten haben wir es hier zu tun.
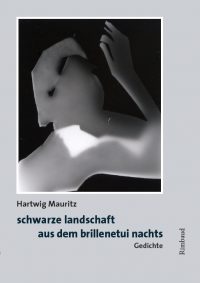
Autor:
Mauritz, Hartwig
Frühe Gedichte
64 S., 2021
Klappenbrosch., Fadengeh.
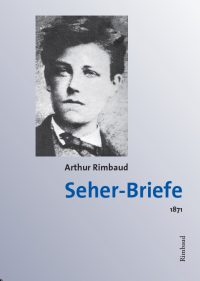
Autor:
Rimbaud, Arthur
(Werke Bd. 5)
Mit einem Nachwort von Bernhard Albers
32 Seiten, fadengeheftet, 2020
Arthur Rimbaud
Werke im Rimbaud Verlag Band 1: Das Trunkene Schiff. Gedichte übertragen von Thomas Eichhorn; 5. Auflage 2010. Band 2: O Zeiten, o Schlösser. Gedichte frz. dt. übertragen von Thomas Eichhorn; 1992. Band 3: Ein Aufenthalt in der Hölle. Übertragen von Thomas Eichhorn; 2001. Band 4: Leuchtende Bilder. Gedichte frz. dt. übertragen von Reinhard Kiefer und Ulrich Prill mit Anmerkungen von Claude Jeancolas und einem Text von Michel Butor; 2. Auflage 2016.
Autor:
Villaurrutia, Xavier
Sämtliche Dichtungen spanisch / deutsch
Hrsg. Alberto Perez-Amador Adam
Übertragen von Curt Meyer-Clason
320 S., geb., 2007
«Seine Dichtung ist eine einsame Dichtung für einsame Menschen, die nicht die Komplizität der Leidenschaften sucht, die heutzutage die Geister tyrannisieren: die Politik, der Patriotismus, die Ideologien. Keine Kirche, keine Partei und kein Staat kann Interesse daran finden, für Gedichte zu werben, deren Anliegen – besser: Besessenheiten – der Traum sind, die Einsamkeit, die Schlaflosigkeit, die Unfruchtbarkeit, der Tod. Dazu erscheint die Erotik, Großfetisch unseres gefühllosen und grausamen Jahrhunderts, in seinen Gedichten wie eine geheime Leidenschaft, deren sichtbarste Merkmale der Zorn sind, die Dürre, die Impotenz, die Sprödigkeit. Nichts an dieser Dichtung vermag Leser anzuziehen, die wie die Mehrzahl unserer Zeitgenossen das Leben, ohne das der Instinkte und des Geschlechts auszuschließen, auf ideologische Kategorien beschränken. Villaurrutias Poesie ist nicht antisozial, sondern asozial.»
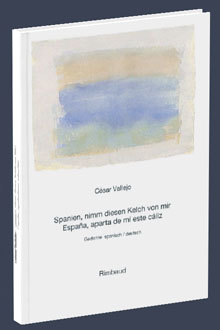
Autor:
Vallejo, César
Gedichte (spanisch / deutsch)
Werke Bd. I, übersetzt von Curt Meyer-Clason,
hrsg., mit Anmerkungen und einem Nachwort von Alberto Perez-Amador
1 Abb., 104 S., geb., m. Lesebändchen, 1998
«Wenn es in der spanischen Sprache einen Dichter gibt, dem Geschichte Wahl und Schicksal gleichzeitig war, eine Leidenschaft, an der man teilhat und die man weitergibt, so war César Vallejo dieser Dichter. Der Peruaner richtet nicht; ebenso wie Whitman nimmt er teil, allerdings umgekehrt: er ist nicht Kläger, sondern Opfer.»
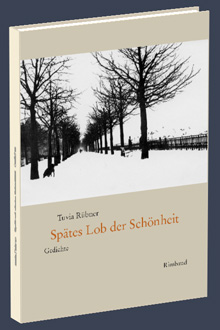
Autor:
Rübner, Tuvia
Gedichte
Mit einem Nachwort von Konstantin Kaiser
10 Abb., 80 S., geb., 2010
"Es ist etwas in Rübners Gedichten, wo wir einen Moment zusammenbleiben können, und wo wir bleiben können, können wir uns auch finden, wenn auch nur in gewährter Frist.(…) Aber was bei ihm kenntnisreich entfaltet ist, ist das Spiel des Gedichts, das Leben des Gedichts mit der Erinnerung. Oft geht es, wie gesagt, um sehr konkrete Erinnerungen, aber manchmal geht es nur darum, daß eine Hand sich vorschiebt, sagt: Da muß Erinnerung sein, jetzt, immer. Kein Schlaf bewahrt vor ihr. An vielen Stellen stellt Rübner die Beziehung von schmerzhaft obsessiver Erinnerung und Schlaflosigkeit dar. Diese moderne Poesie ist auch eine der Schlaflosigkeit, als gelte es durch nicht endende Wachheit dem Vergessen zu wehren." - Konstantin Kaiser
Das Nachwort «Nachdenken über Tuvia Rübner» beruht auf der im Literaturhaus Salzburg im Mai 2008 frei gehaltenen Einleitung zu einer Lesung Tuvia Rübners aus Anlaß des Theodor Kramer Preises für Schreiben im Widerstand und im Exil 2008.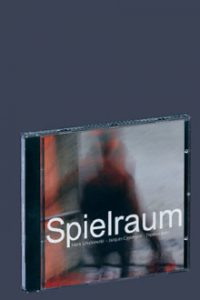
Autor:
Schablewski, Frank
Lyrics und Sprecher: Frank Schablewski
Musikkomposition: Jacques Gassmann
Keyboards, Synthesizer: Jacques Gassmann, Thomas Buhr
CD, 37 Minuten, Begleitheft 8 S., 2006
Frank Schablewski · Jacques Gassmann · Thomas Buhr Anzeiger Atemluftbrücken Dort sein Ledahaut Spielraum Ehehaff
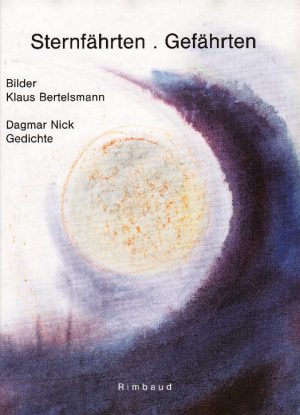
Autor:
Nick, Dagmar
Bilder von Klaus Bertelsmann und Gedichte von Dagmar Nick
31 Abb., 76 S., Großformat, geb., 1993

Autor:
Lanser, Günter
Ausgewählte Gedichte
96 S., geb., 2002
Die vorliegende Sammlung bietet einen Querschnitt durch Günter Lansers poetische Arbeit aus den letzten dreißig Jahren. Der Autor hat nicht sehr viel veröffentlicht, zwischen 1964 und 1984 erschienen die zum Teil recht schmalen Bände «An den Ufern» (1964), «Schwarznebel» (1973), der zweisprachige Auswahlband «Viadukte – Viaducs» (1977) und schließlich «Nachtworte» (1984). Alle diese Bände sind vergriffen oder zum Teil schwer zugänglich, so daß eine erneute Präsentation von Lansers Lyrik schon längst überfällig ist.
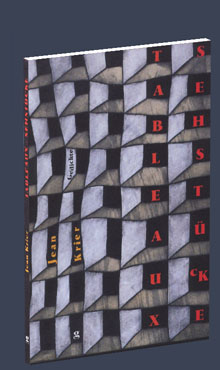
Autor:
Krier, Jean
Gedichte
3 farb. Abb., 96 S., engl. brosch., 2002
Die Sprache, die er (Jean Krier) gebraucht, entspricht seiner Überzeugung vom Zerstörtwerden und Kaputtgehen der uns umgebenden Wirklichkeit. Es ist die Sprache dieser «schlechten» Wirklichkeit, der verdrehten Redewendungen, die wir gedankenlos benutzen und die Jean Krier blasphemisch verfremdet und verstümmelt. Solche Sprache erscheint als einzige ihm angemessen, um unserer Befindlichkeit Ausdruck zu geben … Paradiese, wenn es sie überhaupt noch gibt, sind künstlich, inhaltslos und von kurzer Dauer. So sagen uns die Gedichte von Jean Krier in einer nicht tröstenden, auch in kurzen Passagen artifizieller Munterkeit untröstlichen Sprache viel über das Heillose unserer Existenz. Joachim Sartorius in «Sprache im technischen Zeitalter» Jean Kriers Tableauxgedichte sind auf den ersten Blick unsentimentale, nüchterne Bestandsaufnahmen des Lebens, aber der Untergrund, auf dem sich der Autor bewegt, ist bodenlos, ist, wie das Meer, unberechenbar in seiner Schönheit und Undurchdringlichkeit. Oder, wie es in einem seiner Gedichte heißt: «Wie du dich auch kehrst und wendest, / alle Wege führen daran vorbei, es fällt dir stets / in den Rücken das Meer.» Rosemarie Altenhofer, Hessischer Rundfunk
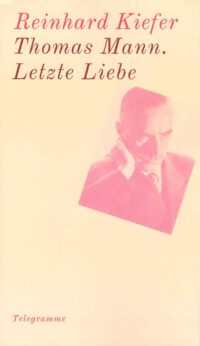
Autor:
Kiefer, Reinhard
Lizenzausgabe des Telegramme-Verlags
65 S., Klappenbroschur, 2025
Trotz der Zufriedenheit, trotz der Gewißheit, große Tage verlebt zu haben, die so gewiß nicht mehr wiederkommen, spürte er in sich zugleich einen starken Mangel an Rührung, an Betroffenheit. Was hatte man denn in solchen Augenblicken des Triumphs, und von solchen hatte er ja schon recht viele erlebt, zu empfinden? Er wußte es nicht mehr genau. Vielleicht hatte er es vergessen. «Was man alles vergißt. Manches will man ja auch vergessen. Man ist dann recht dankbar, wenn es gelingt.» Etwas in ihm war schon sehr weit, schon in Auflösung. Was geschah, das waren Variationen, Wiederholungen auf freilich hohem Niveau.
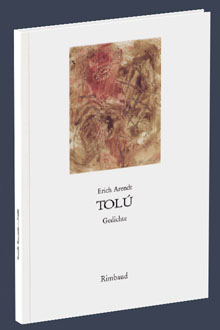
Autor:
Arendt, Erich
Gedichte aus Kolumbien (1973)
(Sämtliche Gedichte Bd. 3)
hrsg. von Gerhard Wolf
96 S., geb., 1997
Erich Arendts Gedichtzyklus «Tolú», zuerst veröffentlicht in seinem Band «Trug doch die Nacht den Albatros», Berlin 1951, der eine Bilanz seines Schaffens im Exil zieht, verzeichnet die Jahre von 1948 bis 1950 als Entstehungszeit der Gedichte. Ein Manuskript dazu liegt uns nicht vor. Sicher hatte er die meisten der Verse oder ihre Entwürfe im Gepäck, als er 1950 aus Kolumbien heimkehrte und in Ostberlin seinen Wohnsitz nahm, an den Wänden die Bilder des Malers Wiedemann, mit dem er in der Emigration in Bogotá befreundet war; Gemälde in den kräftigen, ausschweifenden Farben tropischer Urwaldlandschaft und ihrer Bewohner, «den leisen Indios der Höhen und den elementareren Negern der Stromtäler und Küstenstriche … die Sinne überwältigend … steht Tolú, das Fischer- und Reisbauerndorf an der Moroquillobucht, für den ganzen Tropenbereich, seine Menschen und ihr Leben».
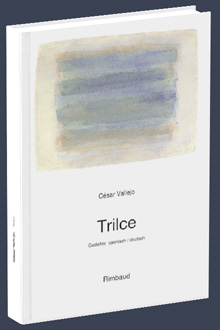
Autor:
Vallejo, César
Gedichte (spanisch / deutsch)
Werke Bd. III, übersetzt von Curt Meyer-Clason,
hrsg., mit Anmerkungen und einem Nachwort von Alberto Perez-Amador
1 Abb., 216 S., geb., m. Lesebändchen, 1998
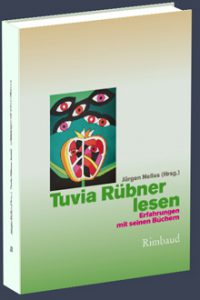
von Jürgen Nelles
Erfahrungen mit seinen Büchern
350 S., geb., 2015
Beiträger: Tuvia Rübner, Jürgen Nelles, Christian Moser, Johannes von Vacano, Arno Hammer, Jon Gestermann, Richard Dove, Christoph Meurer, Franziska Schmidt, Georg-Michael Schulz, Karin Lorenz-Lindemann, Uwe Pörksen, Matthias Fallenstein, Susanne Düwell, Konstantin Kaiser, Hanna Zehschnetzler, Kuno Lorenz, Jürgen Brôcan, Gundula Schiffer, Frank Schablewski, Christine Radde, Bernhard Albers, Michael Braun, Christian Echle, Henning Backhaus, Claudia Schwarz, Hans-Jürgen Schrader, Hans Otto Horch, Christoph Meckel. Tuvia (zu deutsch Tobias) Rübner, 1924 in Bratislava-Pressburg geboren, die Muttersprache deutsch, entkam als einziger seiner Familie im letzten Augenblick dem Meuchelmassen- und Raubmord ins damalige Palästina, das heutige Israel. «Es ist Zufall, dass ich lebe», sagt er. Und dennoch schreibt er 12 Jahre lang deutsche Gedichte in einer Sprache, die er nicht mehr spricht, bis er 1953 völlig ins Hebräische hinüberwechselt (hie und da noch ein deutsches Gedicht, ins Hebräische übersetzt) und schließlich den Israelpreis, die höchste Auszeichnung, erhält. Von der Kritik wird er zu den erstrangigen europäischen Nachkriegsdichtern gezählt. Der Band versammelt sowohl Beiträge zu den Gedichten wie zur Autobiografie Tuvia Rübners, Erinnerungen an Begegnungen und Gespräche mit dem Dichter sowie einige bisher unveröffentlichte Gedichte.
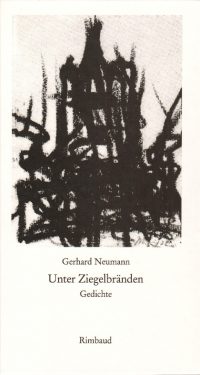
Autor:
Neumann, Gerhard
Gedichte
64 S., geb., 1997
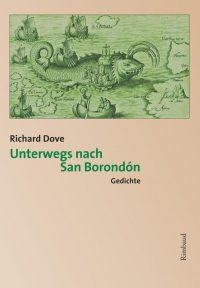
Autor:
Dove, Richard
Gedichte
88 S.; 2020
Klappenbroschur, Fadengeheftet
Unterwegs nach San Borondón
Wer war ich, was bezweckte meine Reise? / An Ceuta fuhren wir vorbei, der Zaun, / An dem Flüchtlinge hingen, klirrte leise Hinüber nach Gabeltariq. Das Grau'n / Des Abendlandes lichtete sich ein Stück, / Gedämpft die Galgenschreie des Alraun. Sein Himmelsgewölbe nahm Atlas zurück, / Fad schmeckte uns die Hesperidenfrucht. / Atlantiswärts wendeten wir den Blick,Ergaben uns treuherzig unsrer Sucht. / Das Kreuz des Südens strahlte uns entgegen, / Das eigne Firmament schwand in der Schlucht ...
(Auftakt des Titelgedichts)
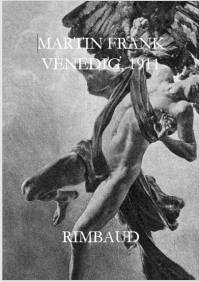
Von Martin Frank
Eine Entsublimierung
Roman
196 S., fadengeheftet, mit Klappen, 2021
"Auf artifiziell höchster Ebene vermittelt Martin Frank nach Luchino Visconti und Benjamin Britten einen weiteren Zugang zu Thomas Manns Novelle."
Bernhard Albers
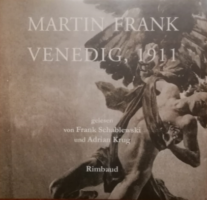
Von Martin Frank
Eine Entsublimierung
Hörfassung nach Romanvorlage
Gelesen von Frank Schablewski und Adrian Krug
MP3-CD
Laufzeit ca. 6 Stunden und 15 Minuten
Ein erfolgreicher deutscher Dichter will im Grand Hôtel einige Tage mit einem Jungen Alles Schöne geniessen:
"Wie lächerlich ist der Glaube, dieses harmlose Vergnügen vermöchte einen Künstler zu zerstören! Wie kann ein ächter Künstler sich entfalten -, sollte es auch das gesunde Volksempfinden verletzen -, wenn er sich von kleinbürgerlichen Vorurteilen einschränken lässt?" Anders als in Thomas Manns Meisternovelle "Der Tod in Venedig" kommt in Martin Franks "Venedig, 1911" auch Tazio zu Wort.
Autor:
Butor, Michel
192 S., geb., 1994
«Ich möchte mich auf den gefährlichen Streit der Experten nicht zu sehr einlassen, ich erhebe in dieser Studie auch nicht den Anspruch, Maßgebliches über die uns erhaltenen Texte beizutragen. Ich werde Leben und Schreiben von Rimbaud als die Abfolge einiger Phasen darstellen. Ich gestehe im übrigen zu, daß man ihre Zahl erhöhen könnte, indem man in einem Jahr auch die Jahreszeiten zählt. Zugleich bemühe ich mich aber darum, das zu kennzeichnen, was sich ändert, ebenso wie das, was über alle Wechselfälle hinweg unabänderlich bestehen bleibt.» Butor beschreibt in seinem Essay, der in Frankreich zuerst 1989 erschien und jetzt in deutscher Übersetzung vorliegt, Rimbauds rätselhaften Lebensweg: vom Selbstverständnis seiner Lyrik als Ausdruck der Revolution gegen Konventionen aller Art bis zur Restauration eines Kaufmannes in Äthiopien.
Autor:
Fried, Erich
Reden anläßlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde an Erich Fried durch den Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaft der Universität Osnabrück am 20. Januar 1988
2 Abb., 55 S., brosch., 1988
«Engagement, Moral, hohes humanes Ethos kennzeichnen in besonderem Maße das Werk Erich Frieds. Er ist einer der engagiertesten Autoren der Gegenwart. Auch weil er es sich selbst auferlegt hat, zu politischen, die Menschenrechte berührenden Fragen in der Bundesrepublik nicht zu schweigen, hat er hier eine große Leserschaft gefunden.»
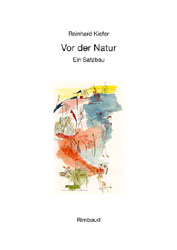
Autor:
Kiefer, Reinhard
Ein Satzbau
248 S., fadengeh. Klappenbrosch., 2001
Mit «Vor der Natur» übernimmt der Autor den gelegentlich radikalen Versuch, das festgefügte Koordinatensystem des Alltäglichen aufzubrechen. Sein ebenso kokettierendes wie provozierendes Spiel ist darauf angelegt, jene prädisponierten Bilder in Frage zu stellen, die uns – zum Beispiel via TV und Werbung – fortwährend ein Gefühl von Ich-Gewißheit vorgaukeln. Wer solchen «Einflüsterungen» erliegt, droht, so könnte man interpretieren, Opfer seiner eigenen Lethargie zu werden. Aufgabe von Kunst ist es hingegen, kritische Distanz zu üben und die Autonomie und Unabhängigkeit des Individuellen zu betonen. Hiermit einher geht das Postulat, unbekanntes, vielleicht auch unbewußtes (Erzähl)Terrain auszuloten.
Autor:
Bachmann, Guido
Erzählung (1967)
20 S., brosch., 1983
Vergriffen! Out of print!
Kleist gab keine Antwort, ging hin und her, hämmerte sich mit der Faust an die Stirn und befahl nach einer Weile dem herbeizitierten Hausdiener, er möge vier Lichter bringen, die während der ganzen Nacht brannten. Es fröre ihn, sagte Kleist, es fröre ihn, obwohl im Ofen das Feuer brannte, es fröre ihn.
Bachmann beschreibt Kleists letzte Tage in einer farbigen, Kleist nahen Sprache. Guido Bachmann, geboren am 28. Januar 1940 in Luzern, starb am 19. Oktober 2003 in St. Gallen.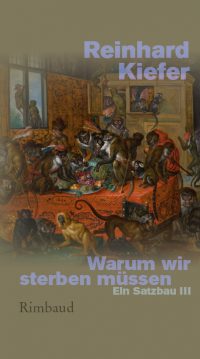
Autor:
Kiefer, Reinhard
Ein Satzbau III
156 S., Klappenbrosch., 2019
Nach «Vor der Natur» (2001) und «Die Wiedereinführung der Sprichwörter» (2009) legt Reinhard Kiefer nun den dritten Band seines «Satzbaus» vor. Der Begriff «Satzbau» erinnert nicht zufällig an Schwitters «Merzbau». Wie dieser ist Kiefers «Satzbau» geprägt vom Prinzip der Collage: Absicht und Zufall treffen aufeinander. Zitate, Geschichten, Aufzeichnungen und Reflektionen umspielen in denkbar weitem Rahmen die Frage «Warum wir sterben müssen».
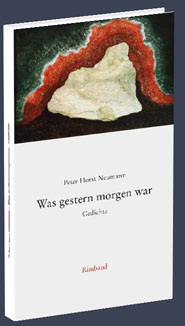
Autor:
Neumann, Peter Horst
Gedichte
96 S., geb., 2006
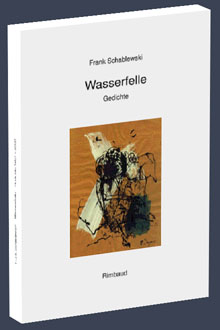
Autor:
Schablewski, Frank
Gedichte 1984–2000
176 S., geb., 2001
Muttermal sich gegenseitig die Blöße gegeben den Mund zu halten zwischen Zahnhälsen auf dem Zungengrund mit der Kuppe zu fingern verkehrt mit dem Kopf in eigenen Kreisen
| veröden voll Schweiß | |
| Muttermale |
| Silber | |
| steif am Horizont von gestern |
Autor:
Hagen, Siegfried
2 Abb., 58 S., fadengeh. Brosch., 1985
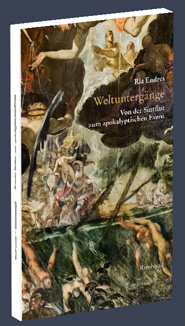
Autor:
Endres, Ria
Von der Sintflut zum apokalyptischen Event
Ein Essay und ein Hörstück
9 Abb., 116 S., brosch., 2019
Auf und nieder auf und nieder / Wunder gibt es immer wieder /
Wir wären alle schön verrückt / Wenn uns der Untergang nicht glückt / Was sagt uns der Prophet? / Wenn die Welt schon untergeht / Kommt alle Buß und Reu zu spät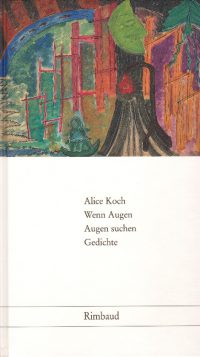
Autor:
Koch, Alice
Gedichte
56 S., geb., 1993
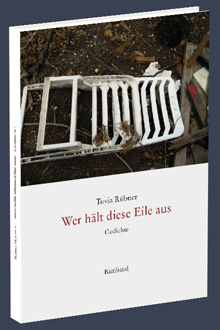
Autor:
Rübner, Tuvia
Gedichte
92 S., geb., 2007
Ratschläge für einen jungen Dichter
Bleib dem Gedanken treu dem verlassenen Lausche dem Klang mit verschlossenen Ohren Hör mit den Händen Schlage den Takt ohne etwas zu rühren Vergiss Marsyas und seine abgezogene Haut Vergiss Orpheus und sein zerrissenes Fleisch Vergiss den Spott, Vergiss den Rauch, vergiss das Feuer Vergiss dein Herz, vergiss dein Hirn Die Stimme in der Kehle wer du bist Und, wenn möglich, so beginn im Schweiße deines AngesichtsAutor:
U Tam’si, Tchicaya
Gedichte (französisch / deutsch)
hrsg. und mit einem Nachwort von Hans-Jürgen Heinrichs
1 Abb., zus. 416 S., geb., 1999
Autor:
Neumann, Gerhard
Gedichte
36 S., brosch., 1956
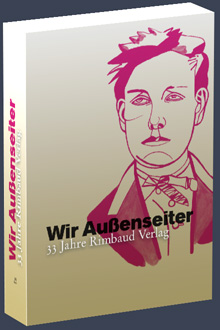
Hrsg. von Bernhard Albers
143 Abb., 464 S.,
Klappenbrosch., 2015
[3d-flip-book id="3657" ][/3d-flip-book]
Seit 2020 befindet sich das Archiv des Rimbaud Verlages in der Hand der Berliner Akademie der Künste. Rimbaud Verlag im Archiv der Berliner Akademie der Künste
-Zimmermann, Hans Dieter: Ein Rückblick auf 80 Jahre. Und was ich der Gruppe 47 verdanke. Erinnerungen. Klagenfurt, 2021.
Autor:
Rübner, Tuvia
Gedichte
81 S., geb.,
(1. Auflage 1990 im Piper Verlag, Herausgegeben, übersetzt und mit einer Nachbemerkung von Efrat Gal-Ed und Christoph Meckel)

Autor:
Mauritz, Hartwig
Gedichte
64 S.; 2020
Klappenbroschur, Fadengeheftet
nachtspiel
deine beobachtung schafft sterne, geschliffene bilder, einen mond dessen schatten dem meer folgt. hörst du den himmel rauschen über dem horizont weht ein verlassener wind, fordert die bewegung des schlafs, auf dessen planken du stehst und in die träume einbrichst träge zieht das schiff seine bahn, wenn dir die kugel ins glas sinkt treiben umher weithin verstreute horizonte, gekreuselte wellen wasser, das abfließt, zurückkehrt, sich türmt. zugvögel schlagen die luft unter ihren flügeln dreht sich der wind. es ist das ufer, das sich bewegt bleibt nur die sonne im hafen. weit hinter den schlaf gefallen verbrennt sie die dunkelheit.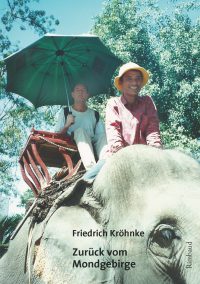
Autor:
Kröhnke, Friedrich
Erzählung
(Erstabdruck 1993 in: “Dieser Berliner S0mmer”)
31 S., geheftet mit Klappen, 2019
Kein fester Punkt. Die Erde kreist, und von der Zeitverschiebung verwirrte Passagiere sind mit dabei, Pakete günstig gekaufter Zigaretten unterm Arm, und keiner erwartet sie.
Schau dir meine Schätze an, sagt Adrian zu dem Jungen, geh alle Stapel durch, Jacken und Halstücher, such dir aus, was du magst.
Autor:
Bertram, Ernst
Ausgewählte Gedichte 1911–1955
Nachwort von Ralph-Rainer Wuthenow
1 Abb., 87 S., fadengeh. Brosch., 1988
Aus dem Gedichtwerk stellt diese Ausgabe eine repräsentative Auswahl vor, die zeigen soll, daß es sich lohnt, an den Dichter zu erinnern.

Autor:
Kiefer, Reinhard
Gedichte
32 S., brosch., 1983
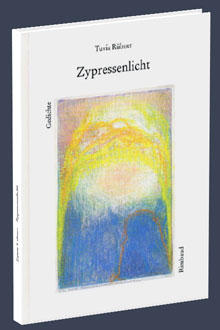
Autor:
Rübner, Tuvia
Ausgewählte Gedichte II (1957–1999)
96 S., geb., 2000
Am hellen Tag
Wo kam ich hin am hellen Tag? Kam ich hierher am hellen Tag? Der Mann im Boot schwenkte sein Ruder und setzt wieder über zum anderen Ufer. Ein Hund hob das linke Bein, verstreute Reste von Schalen, das Licht ein wenig zypressenhaft. Ich sprach zu mir. Hierher kam ich, sprach ich zu mir, und weshalb kam ich hierher am hellen Tag? Ein kleines Mädchen, einen Fink in der Hand, glaubte, sie könne sich drücken. Auch Kinder - schwenkte sein Ruder und setzt wieder über zum anderen Ufer - kommen hierher. Wie Schatten bin ich hier im eigenen Herzen Wie Schatten mein Herz. Weshalb kam ich hierher am hellen Tag? (übersetzt von Manfred Winkler)